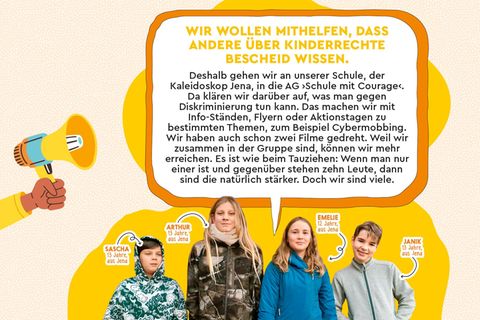Mein lieber Herr Gesangsverein!
"TOOOOOOR! TOOOOOOOR! TOOOOOOOR!", schallt es aus den großen Lautsprechern am Spielfeldrand. Lena und Mareike fallen sich jubelnd um den Hals - gemeinsam haben sie soeben das 8:0 im städtischen Hockey-Finale erspielt. Kurz danach ertönt der Abpfiff - und mit ihm das Signal für den Saisonsieg.
"Mein lieber Herr Gesangsverein! Ich wusste ja, dass wir eine super Mannschaft sind. Aber von einem solchen hohen Sieg habe ich nicht zu träumen gewagt", lobt Trainer Ulli seine Hockey-Mannschaft nach Ende des Spiels.
Die Mädchen schauen ihren Trainer verwirrt an: Wieso denn Gesangsverein? Schließlich spielen sie Hockey und singen nicht im Chor...
Die Geschichte hinter der Redewendung
Auch, wenn man es vermuten mag - die Herkunft der beliebten Redensart "Mein lieber Herr Gesangsverein" wurzelt ursprünglich keineswegs in der Musikszene. Stattdessen ist der Ausspruch auf das Alte Testament zurückzuführen.
Denn in der Bibel steht als eines der zehn Gebote geschrieben: "Du sollst den Namen Gottes, Deines Herrn, nicht unnütz brauchen." (2. Buch Mose,Kapitel 20, und 5. Buch Mose, Kapitel 5)
Im Laufe der Zeit haben sich daher viele Umschreibungen für das Wort Gott entwickelt, um in der Alltagssprache nicht den Namen Gottes allzu leichtfertigt zu benutzen. Auch der spontane Ausruf "Mein lieber Herr!" zählt als eine solche Anrufung Gottes. Da man den Namen Gottes jedoch nicht benutzen soll, wenn man sich wundert oder vielleicht sogar flucht, sucht man sich stattdessen andere Begriffe - zum Beispiel "Mein lieber Scholli".
Auch die Redewendung "Mein lieber Herr Gesangverein“ kam aus diesem Grunde auf - genauer im 19. Jahrhundert, als Gesangvereine sehr in Mode waren. Man ersetzte die Floskel also einfach durch ein anderes Wort ein, und vermied auf diese Weise die Gotteslästerung.
Eine ähnliche deutsche Redewendungen lautet übrigens auch "Alter Schwede!".