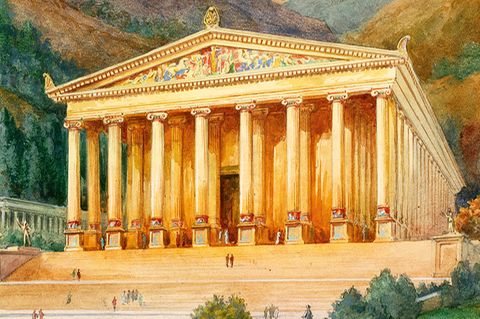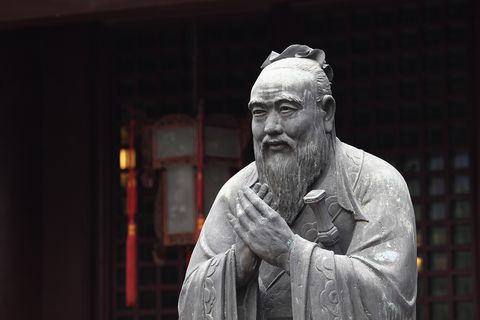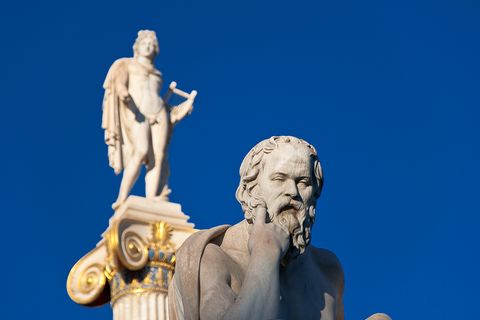Das Geheimnis der Nasca-Linien
Vor mehr als 2000 Jahren begannen Menschen vom Volk der Nasca, gigantische Formen und Figuren in die Atacama-Wüste in Peru zu ritzen. Warum? Diese Frage sorgte lange Zeit für wilde Spekulationen. Doch Forschern ist es gelungen, die Bodenbilder zu entschlüsseln.
Und dann sitzen sie an diesem Abend wieder in ihrem Grabungscamp, grübeln, grämen sich. Vor Markus Reindel und seinen Kollegen liegt ein Scherbenhaufen. Zerbrochene Keramik, Teile antiker Töpfe, Gold. All das haben die Archäologen in der Atacama-Wüste, im Süden Perus, gefunden.
Aber sie suchen doch nach etwas anderem: einer Antwort dar auf, was die riesigen Erdzeichnungen dort zu bedeuten haben. Ein Vogel - fast so groß wie ein Fußballfeld - ist in den sonnengebackenen Boden gescharrt. Ein Affe, durchkreuzt von kilometerlangen Linien. Das Küstenvolk der Nasca soll sie vor mehr als 2000 Jahren in die Pampa geritzt haben.
Bloß: Warum? Reindel und seine Leute haben keine Erklärung. Dabei forschen sie seit vielen Jahren. "Man kann daran verzweifeln", sagt Reindel. So geschehen im September des Jahres 2000.

Die Erfoschung der Nasca-Linien
Reindel wäre nicht der Erste, den die "Nasca-Linien" beinahe wahnsinnig gemacht hätten. Seit 60 Jahren fahnden Forscher nach einer Erklärung für die Erdzeichnungen - Geoglyphen genannt. Als hätte jemand die Seiten eines gigantischen Bilderbuchs ausgebreitet, liegen sie da im Hochland der Anden: Geraden und Zickzacklinien, Formen und Figuren, so groß, dass man sie eigentlich nur aus der Luft in Gänze erkennen kann.
Genau deshalb sind die Nasca-Linien auch über Jahrhunderte vergessen. Erst als um 1920 erste Flugzeuge die Wüste überqueren, werden sie wiederentdeckt. Der amerikanische Geschichtsprofessor Paul Kosok ist 1939 der Erste, der die Bodenbilder wissenschaftlich erkundet.
Kosok erkennt, wie die Linien einst entstanden sind. Die Nasca, die hier etwa bis zum Jahr 600 lebten, scharrten den "Wüstenlack" - tiefbraunes Gestein - ab, bis der helle Untergrund freilag. Dieser Gegensatz macht die Zeichnungen sichtbar. Und weil es fast nie regnet auf diesem Flecken Erde und auch kaum Wind die Spuren verwischt, bestehen sie bis heute.
Maria Reiche ist fasziniert von den Nasca-Linien
Kosoks Berichte faszinieren eine junge Deutsche so sehr, dass sie alles hinwirft und sich ab 1941 ganz und gar den Nasca-Linien verschreibt: Maria Reiche, die bis dahin Mathematik in Perus Hauptstadt Lima lehrt. Wochen, Monate, am Ende 40 Jahre lang marschiert die hagere Frau durch die Wüste, vermisst, kartiert. Lässt sich einmal sogar samt Kamera auf die Kufen eines Hubschraubers binden, um aus der Luft einen besseren Überblick zu erlangen.
Maria Reiche ist überzeugt davon, dass es sich bei den Linien um einen astronomischen Kalender handelt. An ihm lasen die Nasca, behauptet sie, günstige Termine für Aussaat und Ernte ab. Doch ihre Ideen treffen auf wenig Zustimmung.
Die Linien zeigten Wasserleitungen an, halten die einen entgegen. Sternenbilder, sagen die anderen. Der Schweizer Schriftsteller Erich von Däniken behauptet 1968 gar, es handele sich um Landebahnen für Außerirdische!

Viele vergebliche und verrückte Erklärungsversuche
Markus Reindel kennt sie alle, als er Mitte der 1990er Jahre beginnt, sich genauer mit den Nasca-Linien zu beschäftigen. Der Forscher vom Deutschen Archäologischen Institut in Bonn wundert sich. Bislang haben alle Wissenschaftler versucht, Muster in den Erdzeichnungen zu erkennen und so die Nasca-Linien aus sich selbst heraus zu erklären. Reindel dagegen ist sich sicher: "Wenn wir etwas über die Linien wissen wollen, müssen wir ihre Zeichner, die Nasca, besser kennenlernen."
Der Archäologe sucht Mitstreiter in Deutschland, in den USA, der Schweiz und Peru. Anfang 1997 beginnen die Arbeiten in den einstigen Nasca-Siedlungen. Die Wissenschaftler untersuchen erhaltene Mumien, graben ganze Ortschaften aus. Um halb fünf Uhr in der Früh beginnen ihre Arbeitstage und enden spät in der Nacht, tief gebeugt über Karten, Skizzen und - Scherben.
Doch die Funde und Forschungsergebnisse der ersten Jahre wollen nicht zueinanderpassen; als seien es Puzzleteile unterschiedlicher Bilder. Im Team kommt Unruhe auf, Ungeduld und die bange Frage: Wird es auch uns nicht gelingen, das Geheim nis der Nasca-Linien zu lüften?
Da trifft Markus Reindel im September 2000 eine wegweisende Entscheidung:
"Aufhören!", bestimmt er. "Wir fangen von vorn an." Und zwar doch an den "Scharrbildern" in der Wüste! Denn Reindels Leute haben neben den Nasca-Linien Steinhaufen entdeckt, fast 50 insgesamt. Unwichtig, dachten sie anfangs. Aber wenn sie doch den entscheidenden Hinweis bergen?
In der Wüstenhitze, die alles flimmern und das Atmen zur Qual werden lässt, heben sie Stein um Stein, schürfen tiefer und stoßen auf Mauerwerk. Reste antiker Textilien, Tierknochen, Scherben tauchen auf. Handelt es sich bei den Steinhaufen etwa um verfallene Tempel, in denen einst den Göttern geopfert wurde?
Weitergraben! Im Schutt entdecken die Forscher dann Schalen von Spondylus-Muscheln: Tiere, die es in Südperu nie gegeben hat. Die Muscheln wurden, das ist bekannt, von den Küsten Ecuadors herbeigeschafft und galten als Zeichen für Fruchtbarkeit und Wasser.
Flehten die Wüstenbewohner also die Götter um Regen an? Reindel schickt die Klimaforscher im Team raus, abermals Bodenproben zu nehmen; darin können sie lesen wie in einem Wetter-Archiv. Er schaut sich die Bodenbilder an. Und plötzlich passen die Puzzleteile doch!
Reindel hatte sich lange gefragt, warum die Nasca gerade Affe und Kolibri in den Wüstenboden gescharrt hatten - Tiere, die im tropischen Regenwald leben. Jetzt begreift er, es war eine Art Wunschzettel an die Götter: Schickt uns das Wetter von dort!
Denn die Bodenproben zeigen: Das Land der Nasca, einst eine blühende Landschaft, trocknete aus. Als hätte man der Region den Hahn abgedreht, fiel vor dem Jahr null auf einmal kaum Regen mehr. Ab 100 nach Christus dürsteten die Nasca. In ihrer Not begannen sie, neben den Tieren auch Linien und Flächen anzulegen, auf denen sie Prozessionen abhielten.
Immer wieder. Untersuchungen belegen: Der Wüstenboden ist stark verdichtet - platt getreten von Abertausenden Menschen.
Markus Reindel ist sich darum nun sicher: "Nicht die Linien waren wichtig, sondern das, was darauf passierte", sagt er. "Sie waren Freilichttempel, in denen die Menschen gegen die Trockenheit anbeteten." Doch die Götter erhörten ihre Hilferufe nicht. Und so mussten die Nasca um das Jahr 600 die Atacama-Wüste verlassen, bauten sich ein neues Leben in den regenreicheren Bergen der Anden auf.
Markus Reindel hat es ihnen gleichgetan. Als im Jahr 2005 das Rätsel um die Nasca-Linien endlich gelüftet ist, zieht er mit seinem Team ebenfalls Richtung Osten, in die Berge. Denn auch dort haben die Nasca einen riesigen Scherbenhaufen hinterlassen.