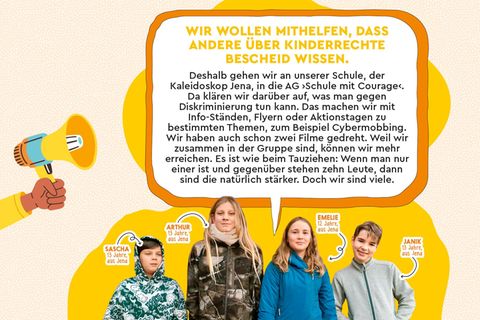Federn sind nicht nur zum Fliegen da
Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich! Wer einem Paradiesvogel bei der Balz zusieht, dem schießt sofort ein Gedanke durch den Kopf: Du Angeber! Das Männchen hebt einen Federbusch an, der sonst unter den Flügeln liegt, und breitet ihn zu einem 60 Zentimeter großen Fächer aus. Lange, fransige Federn kommen zum Vorschein, die golden und orange strahlen, so, als ob ein Maler sie in zu viel Farbe getaucht hätte. „Ho – ho – ho – ho!“, ruft das Männchen und stolziert umher, damit es auch garantiert alle Weibchen bemerken.
Federn sind eben nicht nur zum Fliegen da – sie sind verblüffend vielseitig. Manchen Vögeln dienen sie als farbenfroher Schmuck, mit dem sie ihre Angebetete beeindrucken, anderen als braune Tarnkappe, die sie im Gehölz für Feinde unsichtbar macht. Federn lassen Regentropfen abperlen, halten auch bei Minustemperaturen kuschelig warm und schützen die empfindliche Vogelhaut vor Verletzungen.

Die Federkunde heißt auf schlau: Plumologie
Zwerge wie Kolibris besitzen ein Gefieder aus nur rund 1000 einzelnen Federn. Schwäne dagegen können locker bis zu 30 000 Federn am Leib tragen! Den Leichtgewichten haben Wissenschaftler längst ein eigenes Forschungsgebiet gewidmet. In der „Plumologie“, auf Deutsch Gefiederkunde, untersuchen sie etwa, was Adlerfedern von Habichtfedern unterscheidet. Oder weshalb ein Mauersegler harte, dünne Schwingen hat – während das Gefieder von Eulen eher einem luftigen Kissen ähnelt.
Oft kleben Plumologen alle Federn eines Vogels geordnet auf ein Blatt, damit sie sofort erkennen können, welche Feder an welcher Stelle des Gefieders sitzt. Schaut man ein solches „Rupfungsblatt“ an, fällt eines sofort auf: Obwohl alle Federn aus Keratin bestehen, dem Material, das auch unsere Haare in Form hält, gleicht kaum eine der anderen!
Bei Federn gibt es verschiedene Funktionstypen
Jeder Vogel besitzt große und kleine, harte und flauschige: ein Team von Spezialisten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Borstenfedern etwa sind lang und dünn; sie wachsen in den Schnabel- oder Augenwinkeln von Vögeln und dienen zum Tasten – wie die Schnurrhaare einer Katze. Einige Vögel haben sogenannte Puderdunen, die tatsächlich ein wasserabweisendes Puder bilden, mit dem die Tiere ihr Gefieder einstäuben.
Fadenfedern wiederum sehen aus wie lange Haare; sie wachsen am Fuß größerer Federn und „überprüfen“ ständig, ob die auch richtig liegen; für diese Aufgabe sind die Fädchen mit Nervenenden verbunden, die in die Haut führen. Die langen Hand- und Armschwingen dagegen sind stabil und elastisch, weil sie beim Flug extrem beansprucht werden. Sie müssen scharfe Richtungsänderungen aushalten und bis zu 80 Flügelschläge pro Sekunde, in Extremfällen auch orkanartigen Wind.
Vögel haben den Klettverschluß erfunden

Mauersegler etwa stürzen sich mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde auf ihre Beute. Bei dieser Windstärke könnten sogar Hausdächer wegfliegen! Die Federn an den Flügeln besitzen deshalb kräftige Stämme, die „Kiele“. An ihnen wachsen „Federäste“ nach rechts und links, von denen wiederum kleine Ästchen, die „Strahlen“ abgehen. Diese sind über winzige Häkchen fest miteinander verbunden, genau wie bei einem Klettverschluss! Durch diese geniale Konstruktion bilden sie eine geschlossene, stabile Tragfläche, die trotzdem sehr elastisch ist. Verheddert sich der Vogel etwa in einem Dornenstrauch, werden seine Federn nicht zerschlitzt: Wenn ein Dorn hindurchfährt, trennen sich die Federästchen kurz und kletten anschließend wieder aneinander.
Menschen schmücken sich gerne mit fremden Federn
Falls doch einmal eine Feder knickt, hilft den Vögeln die Mauser: Sie erneuern von Zeit zu Zeit ihr komplettes Gefieder. Bei großen Vögeln wird meist eine Feder nach der anderen ausgetauscht, sodass sie trotzdem jederzeit fliegen können. Manch andere, zum Beispiel bestimmte Entenarten, laufen während der Mauser aber auch komplett nackt herum, weil sie ihr altes Federkleid nach der Brut vollständig ablegen. Andere Vögel mussten lange Zeit unfreiwillig Federn lassen: weil der Mensch hinter den unglaublichen Farben und Mustern ihres Kleides her war, wären einige Vogelarten fast ausgestorben. Federboas, Schuhe mit Kolibrifedern . . .

Heute halten uns Federn im Bett kuschlig warm
Noch vor 100 Jahren pflegten Damen auf Festen üppig dekoriert mit exotischem Gefieder zu erscheinen. Indianer steckten sich Adlerfedern an. Sie glaubten, dass dadurch der Mut des Vogels auf sie übergehen würde. Heute gelten für den Handel mit Vogelgewändern zum Glück strenge Gesetze. Trotzdem sind Federn nach wie vor gefragt – vor allem, um uns warm zu halten. Bettdecken und Jacken sind oft mit Gänse- oder Entendaunen gefüllt, den winzigen Federn, die Vögel tief unter ihrem Deckgefieder tragen.
Daunen sind die "Unterwäsche" der Vögel
Daunen sind erstaunliche Gebilde: Sie ähneln feenhaft feinen Flocken. Doch zwischen ihren Härchen bleiben wärmende Luftteilchen hängen wie in einem Käfig. Der Kälteschutz funktioniert so gut, dass Pinguine mit ihrer Daunen-„Unterwäsche“ sogar bei minus 50 Grad Celsius in der Antarktis überleben. Und noch einen Vorteil haben die Daunen: Sie sind wirklich federleicht. Jede der Minifusseln wiegt sage und schreibe nur ein Tausendstel Gramm, ein dickes Federbett aus Gänsedaunen gerade mal 1000 Gramm. Wenn man darin schläft, kann man sich fast wie ein Vogel fühlen..