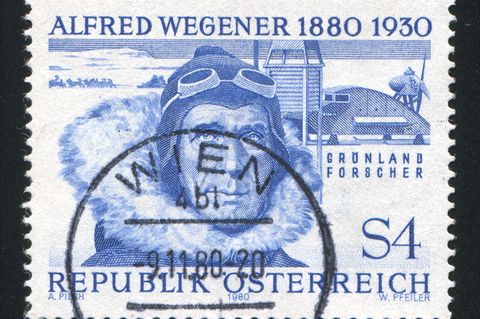Hast Du Angst vor wilden Tieren? Nein? Bist Du auch nie genervt, wenn Schmutz und Schweiß auf Deiner Haut verkleben, wenn Mückenschwärme über Dich herfallen? Ekelst Du Dich überhaupt nicht vor Würmern, Schlangen, Spinnen oder gar vor faulenden madenstrotzenden Tierkadavern?
Dann hast Du schon ein paar Eigenschaften, die Tierforschende haben oder sich aneignen müssen. Und Du würdest Dich wohlfühlen an einem Arbeitsplatz wie dem Wissenschaftlercamp in Westafrika, das deutsche Biologinnen und Biologen vor einigen Jahren in den Savannen der Elfenbeinküste eingerichtet haben, um die Tiere in den Tropen zu erforschen. Aber auch was Dich hier sonst noch erwartet, muß Dir klar sein: Anstrengung, Gefahr und nur wenig Geld.
Leopardenforscher - ein Traumberuf?
Warum nehmen die jungen Leute hier das alles auf sich? Fragen wir den Leopardenforscher Matthias Groß, der die Raubkatzen schon in seinen Armen gehalten hat. "Es ist der wunderbarste Beruf, den ich mir vorstellen kann", sagt er, obwohl er am Anfang ganz schön Angst gehabt habe vor den wilden Tieren. Seine Kolleginnen, Kollegen und Freundinnen und Freunde, etwa die Antilopenforscherin Frauke Fischer oder der Käferexperte Frank-Thorsten Krell, nicken zustimmend. Für sie gebe es nichts Besseres – trotz allem.
Die Liebe zu den Tieren
Denn sie haben eines gemeinsam: Die Liebe zu den Tieren. Alle haben schon als Kinder gewußt, dass "die Viecher" etwas ganz Wichtiges für sie sind. Jeder hat nach dem Abitur ein Biologiestudium hinter sich gebracht und als Hauptfach Zoologie gewählt, die Tierkunde.
Oder auch Ökologie, die Lehre von den komplizierten Wechselbeziehungen der Lebewesen und deren Umwelt. Und alle drei wollten unbedingt in die "Feldforschung" und nicht in einem Labor "versauern" und über Reagenzgläsern brüten.
Obwohl auch sie, wie alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, viel lesen, lernen und lange schwierige Forschungstexte aufschreiben müssen, haben sie sich einen Traum erfüllt: "Wir sind jetzt ganz nah dran an den wilden Tieren."
Die quirlige Frauke hat sich schon vor Jahren den Antilopen verschrieben und deren "zarter Wildheit". Frank-Thorsten hat bereits als Siebenjähriger eine Käfersammlung zum Ärger seiner Mutter auf dem Küchentisch sortiert. Und Matthias verbrachte Stunden im Zoo, weil die "eleganten wilden Katzen" es ihm so angetan hatten.
Arbeitsplatz: Westafrika
Hier nun, in Westafrika, lockt der 30-Jährige sie mit Fleischködern in selbstgebaute Fallen. Er schläfert sie mit Hilfe eines Blasrohres und einer an einem Pfeil befestigten Betäubungsspritze vorübergehend ein. Dann vermißt er sie, wiegt sie, fühlt ihren Herzschlag unter seinen Händen.
Und schließlich legt er den Tieren ein Halsband mit einem kleinen Sender um und spritzt ihnen danach ein Gegenmittel unter die Zunge, damit sie schnell aufwachen und in die Freiheit zurückkönnen.
Der Beruf als Lebensaufgabe
In der Zeit darauf sieht Matthias die Leoparden nur noch selten. Aber er steht mit ihnen elektronisch in Verbindung: Er empfängt die Impulse des kleinen Senders an den Hälsen der großen Katzen mit einem sogenannten Telemetriegerät. So kann er den unsichtbaren Tieren zu Fuß oder im Wagen folgen.
Er zeichnet deren Aufenthaltsorte in Karten ein, errechnet Entfernungen, die sie zurücklegen, registriert Fundorte von Schlafbäumen und verwesenden Beutetieren, sammelt und trocknet Kothaufen, mit denen sie ihr Revier markieren.
Er speist alle Daten in einen Computer ein, der dann genaue Reviergrößen berechnet. So spannend das auch klingt - Du wirst nicht glauben, welche Eigenschaft ein Tierforscher vor allem haben muß: Er muß geduldig sein. So lauert Matthias nächtelang in der Dunkelheit, um das Jagdverhalten der Katzen zu erkunden.
Frauke beobachtet tagelang Antilopenherden und notiert alle vier Minuten, wann die Tiere äsen, springen, kämpfen, widerkäuen oder ruhen. Und Frank-Thorsten hat schon Zigtausende von Insekten gesammelt und sitzt hernach viele Stunden lang vor dem Mikroskop in seiner Hütte, um die Arten dieser Kerbtiere zu bestimmen und zu systematisieren. "Eine Lebensaufgabe", sagt er.
Noch etwas haben die Tierforscherinnen und -forscher hier gemeinsam: Kampfgeist. "Der größte Feind der Tiere ist der Mensch", sagen sie. Sie versuchen, die Afrikanerinnen und Afrikaner zu überzeugen, nicht ganze Herden auszurotten, sondern rücksichtsvoller zu jagen. Und die besondere Verachtung der Tierforschenden gilt den Touristen, die Felle erlegter Leoparden kaufen.