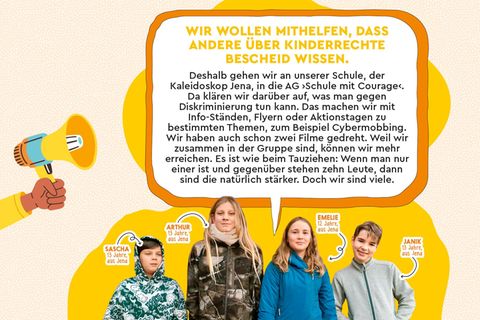Stellt euch folgende Szene vor: Ihr sitzt im Bus, und plötzlich wird es hinter euch laut. Als ihr euch umdreht, seht ihr, dass ein paar Jugendliche eingestiegen sind. Die Gruppe setzt sich zu einem Gleichaltrigen, der auf den hinteren Sitzen auf sein Handy schaut. Dann geht es los: Die Jugendlichen machen blöde Sprüche, bedrängen den Jungen. Als er aufstehen will, reißt ihm jemand das Handy aus der Hand. Ein anderer aus der Gruppe beginnt zu schubsen, droht mit Schlägen – und was macht ihr?
Noch mehr spannendes Wissen gibt's im GEOlino Magazin.
In solchen Situationen einzuschreiten erfordert eine ganz besondere Art von Mut: Zivilcourage, auch Bürger- oder Alltagsmut genannt. Damit ist gemeint, dass sich Menschen trauen, Schwächeren in der Öffentlichkeit beizustehen – zum Beispiel auf der Straße, am Arbeitsplatz oder auf dem Schulhof. Angetrieben werden sie dabei von Werten, die ihnen im Leben wichtig sind. Wenn wir etwa Rassismus, Gewalt und Ungerechtigkeit verabscheuen, mischen wir uns ein, sobald anderen diese Dinge widerfahren – auch wenn es ungemütlich wird. Wer Zivilcourage zeigt, riskiert nämlich oft Nachteile für sich selbst. Die Angreifenden im Bus könnten von ihrem Opfer ablassen und sich stattdessen die Person vorknöpfen, die sich ihnen in den Weg stellt.
Nur wenige greifen im Ernstfall ein
Vermutlich werden manche Menschen, die Zivilcourage zeigen, genau deshalb wie Heldinnen und Helden gefeiert. In Zeitungen und im Fernsehen gibt es Berichte über Mutige, die bei U-Bahn-Schlägereien eingreifen, Mobbing-Opfern helfen oder gegen ausländerfeindliche Parolen aufstehen. In Hamburg erhielten 2017 sieben Männer einen Zivilcourage-Preis, weil sie einen Messerstecher in einem Supermarkt gestoppt hatten. Aber es gibt auch immer wieder andere Schlagzeilen: von Opfern, die dringend Hilfe benötigt hätten, aber keine bekommen haben – obwohl sie von Menschen umgeben waren. Wovon also hängt es ab, ob jemand wegschaut oder Zivilcourage zeigt?

Das Gesetz sagt ganz klar: Wir alle sind bei Gefahr, in Unglücken oder Notfällen verpflichtet, anderen zu helfen. Erwachsene, die nichts tun, können wegen „unterlassener Hilfeleistung“ bestraft werden. Trotzdem haben nur wenige den Mumm, sich im Ernstfall einzumischen. Vor allem bei Gewalttaten kostet das Überwindung. Forschende wollten wissen, was mutige Menschen ausmacht, und haben sich auf die Suche nach der „Heldenformel“ gemacht. Dabei haben sie herausgefunden, dass typische Helfer tatsächlich Gemeinsamkeiten haben: Sie kommen oft aus Familien, in denen die Eltern ihren Kindern auf Augenhöhe begegnen und sie mitbestimmen lassen. So lernen Mädchen und Jungen früh Verantwortung und Selbstvertrauen. Eine weitere Erkenntnis: Auf dem Land zeigen die Leute eher Zivilcourage als in der Großstadt. Das kommt vermutlich daher, dass man sich in der Dorfgemeinschaft kennt und niemand zum Außenseiter werden will, weil er oder sie sich falsch verhält. Die Studien zeigen außerdem einen Zusammenhang zwischen dem Beruf und der Hilfsbereitschaft von Menschen. Besonders häufig mischen sich diejenigen ein, die im Alltag viel mit anderen Personen zu tun haben: Busfahrerinnen, Lehrer, Kindergärtnerinnen …
Bystander-Effekt - Wenn viele Menschen nur zuschauen
Viel entscheidender als die Lebensumstände von Helfenden ist aber die Frage, ob es viele Augenzeugen gibt. Wenn viele zuschauen, schreiten Einzelne bestimmt eher ein, oder? Es klingt verrückt, doch zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Je mehr Menschen in einer Notsituation anwesend sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass jemand eingreift. Das Phänomen, wenn alle tatenlos zusehen, hat sogar einen eigenen Namen. Man nennt es Bystander-Effekt (übersetzt: „Zuschauer-Effekt“).
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären das Verhalten damit, dass wir in solchen Situationen gern die Verantwortung auf andere abschieben. Außerdem ist es oft nicht leicht, Notfälle als solche zu erkennen. Ist das vor unseren Augen ein handfester Streit? Oder eine Rangelei unter Freunden? Sind wir in solchen Fällen unsicher, schauen wir, wie sich Menschen um uns herum verhalten. Wenn wir erkennen, dass keiner der anderen etwas unternimmt, wird das Ganze schon nicht so schlimm sein. Doch handeln alle so, schreitet am Ende niemand ein! Dahinter steckt die Sorge, eine Situation falsch einzuschätzen und sich zu blamieren. Wie peinlich wäre es doch, wenn man sich bei einer Rauferei dazwischenwirft und dann feststellen muss, dass die Beteiligten nur Karate üben …
Jeder und jede kann Zivilcourage zeigen
Neuere Studien zeigen allerdings: Wenn eine Notsituation klar erkennbar ist und es hart auf hart kommt, helfen viele doch. Ein Psychologe der Universität Regensburg zum Beispiel hat mehrere Versuchsgruppen zwei Begegnungen beobachten lassen. Bei der ersten gerieten eine Frau und ein kleiner, schmächtiger Mann aneinander. Beim zweiten Mal war der Täter muskelbepackt und der Frau körperlich klar überlegen – fast alle Versuchspersonen kamen ihr daraufhin zur Hilfe.
Mit unserem Quiz könnt ihr herausfinden, ob ein Alltagsheld oder eine Alltagsheldin in euch steckt.
Und noch eine gute Nachricht: Zivilcourage kann man lernen. Vielerorts bietet die Polizei Kurse an. Die Teilnehmenden üben in Rollenspielen, Notsituationen zu erkennen und entsprechend zu reagieren (lest dazu den Kasten unten). Geraten sie dann einmal in echte Konflikte, stehen sie nicht ratlos herum, sondern können das Gelernte wiederholen. Wer so einen Kurs mitgemacht hat, weiß unter anderem: Es geht gar nicht darum, sich selbst einzumischen oder gar in Gefahr zu bringen – auch jemand, der Hilfe holt, beweist heldenhaften Mut.
So helft ihr richtig!
Pöbeleien, Anfeindungen, Angriffe – jeder kann im Ernstfall helfen und Zivilcourage zeigen. Hier lest ihr, wie ihr euch am besten verhaltet
- Acht geben! Wenn ihr eine Auseinandersetzung mitbekommt, wendet euch nicht ab, sondern schaut genau hin: Benötigt jemand Unterstützung? Wenn ihr unsicher seid, fragt das Opfer, ob es Hilfe braucht.
Hilfe holen! Wenn ihr euch im Bus befindet, sagt dem Fahrer oder der Fahrerin Bescheid. Ist die Situation bedrohlich: Ruft die Polizei! Sprecht umstehende Menschen direkt an: „Sie da, in der grünen Jacke, bitte helfen Sie!“ Lasst Opfer und Täter wissen, dass Gegenwehr organisiert ist.
Abstand halten! Bringt euch nicht selbst in Gefahr. Beschimpft die Täter nicht, vermeidet Diskussionen und fasst sie nicht an – auch nicht zur Beruhigung. Handelt es sich um erwachsene Angreifer: siezt sie. So kann niemand auf den Gedanken kommen, dass sie Bekannte von euch sind.
Perspektive wechseln! Kümmert euch um das Opfer statt um die Täter. Schlagt etwa vor, dass es sich zu euch setzt. Auch ein Ablenkungsmanöver kann funktionieren: Ihr könnt zum Beispiel so tun, als ob ihr das Opfer kennt.
Laufen lassen! Haltet die Täter nicht fest, sondern lasst sie laufen. Prägt euch aber möglichst viele Details ein, damit ihr deren Aussehen beschreiben könnt.