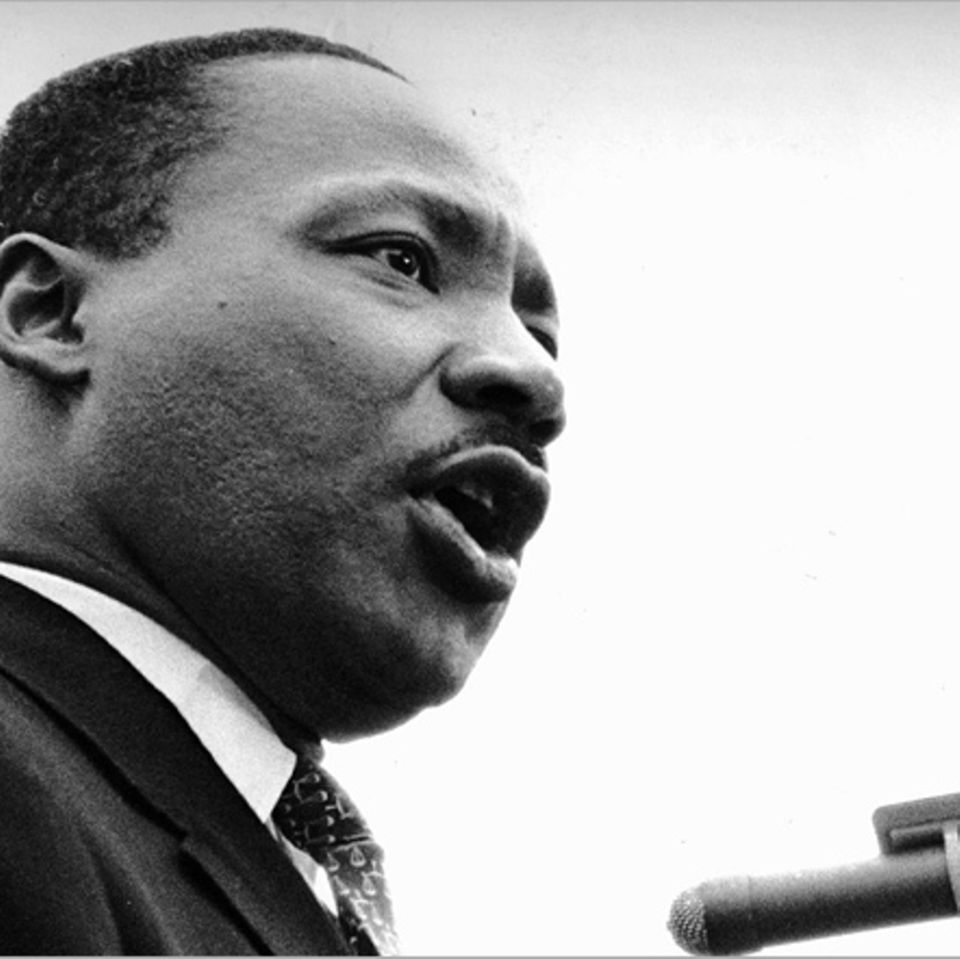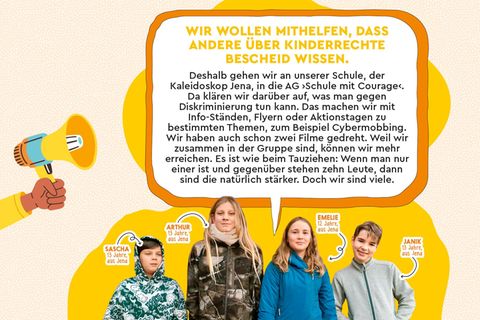England, Ende November 1845: Zwischen Florence Nightingale, ihrer Schwester Parthenope und ihren Eltern fliegen die Fetzen, von besinnlichen Vorweihnachtstagen keine Spur. Warum nur musste Florence dieses Thema ansprechen? Ausgerechnet heute, wo die Familie Besuch hat, platzt die 25-Jährige mit diesem absurden Wunsch heraus: Sie will Krankenpflegerin werden.
Unvorstellbar, finden die Eltern. Schließlich ist Florence eine Tochter aus gutem Hause. Und Krankenhäuser damals so ziemlich das Gegenteil: Sie starren vor Schmutz und stinken, es gibt kein frisches Wasser, Ratten huschen durch die Gänge. Kranke werden dort nur selten gesund und sterben häufig.
Auch die Pflegerinnen haben einen schlechten Ruf. Sie sind oft arm und arbeiten für einen spärlichen Lohn, weil sie keine andere Wahl haben. Außerdem besitzen sie keine Ausbildung und wissen meist nicht, wie sie den Kranken helfen können. Wer genug Geld hat, lässt sich lieber zu Hause pflegen.

Behütete Kindheit
Rückblick: Die Nightingales sind eine reiche Familie, die im Frühjahr und Sommer in einem prächtigen Landsitz an der Südküste Englands lebt. Für die Eltern steht fest: Die Töchter sollen heiraten und sich um Heim und Familie kümmern, wie es sich für junge Frauen aus höheren Kreisen gehört. Schon Mädchen lernen, lieb und gehorsam zu sein. Florence aber fällt das bereits als Kind schwer. Sie gilt als vorlaut, weil sie ihre Meinung sagt. Ihre Mutter Frances wünscht, Florence würde mehr wie die brave Parthenope werden.
Dabei ist Florence ziemlich intelligent und wissbegierig. Seitdem sie zehn Jahre alt ist, unterrichtet sie ihr Vater unter anderem in Griechisch, Französisch, Chemie und Mathe – ganz ungewöhnlich für ein Mädchen dieser Zeit! Oft steht sie schon um drei Uhr nachts auf, um zu büffeln. Dass Florence später einen Beruf ergreift, um eigenes Geld zu verdienen, kommt aber nicht infrage. Die Eltern blieben dabei: Sie muss einen wohlhabenden Mann heiraten. Eine erste Chance ergibt sich 1842.
Florence setzt sich durch
Der britische Außenminister hat Florence und ihre Familie zum Essen geladen. Die Tafel ist reich gedeckt, Silberbesteck klappert. Mit am Tisch sitzt auch Richard Monckton Milnes, ein wohlhabender, junger Baron. Der perfekte Heiratskandidat! Richard ist Politiker, gebildet und 33 Jahre alt. Florence beeindruckt ihn, und bald ist er regelmäßig zu Gast bei der Familie. Für seine Angebetete aber steht fest: Gott will, dass sie Menschen in Not hilft. Als Ehefrau wäre das undenkbar. Also lässt sie ihn jahrelang warten – und lehnt 1849 seinen Heiratsantrag schließlich ab. Die Eltern sind entsetzt.
Später jedoch quälen Florence Zweifel: War das die richtige Entscheidung? Um auf andere Gedanken zu kommen, reist sie durch Ägypten und Europa. Schließlich landet sie in der Diakonissenanstalt Kaiserswerth in Düsseldorf, einer Einrichtung, in der sich unverheiratete Frauen um Kranke und Bedürftige kümmern. Zwei Wochen hilft Florence dort mit, betreut Kinder und notiert eifrig, was ihr auffällt. Besonders beeindruckt sie der tiefe Glaube der Pflegerinnen und die Nächstenliebe, mit der sie die Kranken behandeln.
Florence sieht darin ein gutes Vorbild für englische Krankenhäuser. Obwohl ihre Eltern protestieren, kehrt sie 1851 für drei Monate nach Kaiserswerth zurück, um mehr über die Krankenpflege zu lernen. Von frühmorgens bis spätabends ist sie auf den Beinen, wechselt Verbände, verabreicht Medikamente, hilft bei Operationen und hält Nachtwachen. Harte Arbeit, aber Florence ist glücklich. Sie fasst den Plan, eines Tages selbst eine medizinische Einrichtung zu leiten.

Zwei Jahre später erfüllt sich dieser Wunsch. Florence übernimmt die Leitung des „Instituts für arme Damen“ in London und verzichtet sogar auf eine Bezahlung. Zum Glück unterstützt ihr Vater sie bald mit 500 Pfund im Jahr. Stolz berichtet sie von ersten Erfolgen: Sie sorgt für fließendes Warmwasser auf allen Etagen, lässt einen Aufzug für Speisen sowie Klingeln an den Betten installieren, damit die Patientinnen Hilfe rufen können. Um Kosten zu senken, kauft sie große Mengen an Vorräten.
Schnell wird Florence zur Expertin für Gesundheitsfragen. Die größte Herausforderung ihres Lebens wartet aber noch auf sie …
Einsatz im Krieg
Scutari am Bosporus, 1854: Ein bestialischer Gestank schlägt den Frauen entgegen. Überall liegen Soldaten mit offenen Wunden, manche von ihnen halb verhungert oder mit schwerem Fieber. Es stinkt nach Urin und Schlimmerem. Frisches Wasser, Seife oder Handtücher gibt es fast nicht, dafür jede Menge Dreck.
Das britische Lazarett in der Nähe von Konstantinopel (dem heutigen Istanbul) bietet einen erbärmlichen Anblick. Florence ist entsetzt. Der Kriegsminister in London hat sie zusammen mit 38 Pflegerinnen an diesen Ort entsandt. Denn damals tobt der Krimkrieg. Russland will sein Zarenreich und seine Macht erweitern. Dagegen kämpfen Großbritannien, Frankreich und das Osmanische Imperium, die heutige Türkei.
Zahlreiche Soldaten sterben – aber nicht hauptsächlich auf dem Schlachtfeld, sondern an Seuchen wie der Cholera. In den schmutzigen Lazaretten breiten diese sich rasend schnell aus. Florence und die anderen sollen das ändern.
Die Pflegerinnen organisieren Handtücher, frische Bettwäsche und Seife, verteilen frische Hemden, wechseln regelmäßig Verbände und Laken, lüften die Säle, schrubben die Zimmer, kochen Brühe für die Kranken. So schaffen sie es, dass deutlich weniger Soldaten sterben.
Oft schreitet Florence bis spät in die Nacht mit einer Laterne durch die Gänge, um nach ihren Patienten zu sehen. So erhält sie den heute berühmten Spitznamen „The Lady with the Lamp“ – Die Dame mit der Lampe.

Ein Wunsch wird Wirklichkeit
Als Russland den Krieg verliert, kehrt Florence nach England zurück. Dort wird sie als Heldin gefeiert. Obwohl sie inzwischen selbst schwer krank ist und bald oft das Bett hüten muss, bleibt sie voller Tatkraft. Mit ihren Erfahrungen schreibt Florence ein Buch über die Krankenpflege und gründet 1860 die erste Schwesternschule Englands. Endlich gibt es damit die Möglichkeit, sich professionell zur Krankenschwester ausbilden zu lassen. Sie verfasst Berichte, in denen sie darüber aufklärt, wie wichtig es ist, Krankenhäuser sauber zu halten. Und tatsächlich: Die Politiker hören Florence zu, die Zustände in den Einrichtungen verbessern sich.
Für ihre Leistungen erhält sie im Laufe der Jahre Orden und Auszeichnungen von der britischen Königin und später dem König. Als Florence Nightingale 1910 im Alter von 90 Jahren stirbt, ist ihr Traum von einem erfüllten Leben wahr geworden.
Florence Nightingale: Ein Steckbrief
- Geboren: am 12. Mai 1820 in Florenz
- Familienstand: ledig, sie bleibt zeitlebens unverheiratet
- Lebensleistung: In den Hospitälern, in denen sie arbeitet, verbessert sie die Bedingungen. Später schreibt sie zahlreiche Bücher und gründet eine Krankenpflegeschule. Dadurch wird aus der „Pflegerin“ erstmals ein Beruf mit richtiger Ausbildung. Außerdem sammelt Florence in den Krankenhäusern Daten, zum Beispiel darüber, wie viele Menschen dort wegen fehlender Hygiene sterben. In Diagrammen bereitet sie diese Daten so anschaulich auf, dass Politiker und eine breite Öffentlichkeit verstehen können, wie ernst die Lage ist. Auch dadurch sorgt sie dafür, dass sich die Zustände ändern.
- Gestorben: am 13. August 1910 in London