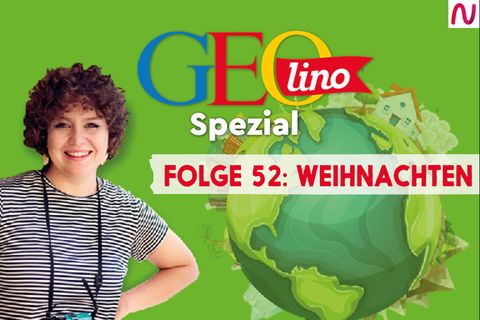Dafür: Schluss mit der Tierquälerei!
Mäuse, Ratten, Fische und Co. leiden in Laboren teils unvorstellbare Qualen, da sind sich Tierversuchsgegner sicher. Forscher schneiden sie auf, infizieren sie mit Krankheitserregern, entnehmen Organe, bestrahlen und vergiften sie – und das vielfach ohne Nutzen. Denn die Ergebnisse aus Versuchen mit Tieren ließen sich oft überhaupt nicht auf den Menschen übertragen, sagt die Vereinigung „Ärzte gegen Tierversuche“. Dass etwa ein Medikament bei einer Maus wirkt, hieße lange nicht, dass es dies auch bei uns Menschen tut.
An vielen Krankheiten, etwa an Parkinson, scheinen Tiere von Natur aus gar nicht zu erkranken. Damit die Wissenschaftler diese trotzdem erforschen können, verändern sie die wehrlosen Lebewesen genetisch, operieren sie oder behandeln sie mit Medikamenten, sodass sie ähnliche Symptome zeigen wie erkrankte Menschen. Sinnlos, sagen die Gegner der Tierversuche. Denn nur weil ein Mittel die Symptome lindere, bekämpfe es nicht automatisch die Ursache der Krankheit und heile diese auch nicht.
Sie fordern daher, die Tierversuche sofort zu stoppen. Immerhin gebe es inzwischen auch eine Reihe „tierfreier“ Methoden: Moderne Computermodelle können berechnen, wie bestimmte Therapien auf den menschlichen Körper wirken. Zudem lassen sich Organe künstlich im Labor nachbilden. Einige Medikamentenhersteller forschen bereits an diesen Methoden, weil sie bisweilen günstiger sind als Tierversuche. Trotzdem: Viele Wissenschaftler oder Politiker vertrauen nur auf das, was sie kennen. Forscher, die neue Methoden verwenden wollen, haben es deshalb noch immer schwer.
Dagegen: Tierversuche retten Leben!
Viele Krankheiten können Ärzte heute nur heilen oder behandeln, weil Wissenschaftler deren Ursache irgendwann einmal an Ratten, Mäusen und anderen Tieren erforschten. Um Kranken zu helfen und unsere Körperfunktionen besser zu verstehen, brauchte es die Versuche auch weiterhin, sagen etwa die Experten der Initiative „Tierversuche verstehen“. Die Abläufe in den Körpern von Menschen und Wirbeltieren ähneln sich eben stark. Und niemand möchte Medikamente direkt am Menschen ausprobieren.
Methoden, die etwa Ärzte gegen Tierversuche nennen, seien längst nicht weit genug entwickelt. Von der Funktionsweise unseres Gehirns beispielsweise hätten Forscher bislang nur einen Bruchteil verstanden. Wie sollte man hier also Computermodelle erstellen? Auch Versuche an einzelnen, künstlich erzeugten Organen reichten häufig nicht aus, weil sich damit nicht feststellen lässt, wie sich ein Medikament auf den gesamten Körper auswirkt.
Wären diese Methoden tatsächlich Alternativen, seien Forscher sogar schon jetzt verpflichtet, diese zu nutzen: Laut Tierschutzgesetz darf ein Tierversuch nur dann stattfinden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und nur zum Vergleich: Zwar gab es im Jahr 2017 rund 2,8 Millionen Versuchstiere im Labor. Mehr als 200-mal so viele landeten allerdings als Schnitzel, Steak und Wurst auf unseren Tellern. Schlachttiere leben in den Ställen und auf den Schlachthöfen bisweilen deutlich schlechter als die Tiere im Labor, sagen viele Forscher. Bei ihren Versuchen achteten sie nämlich darauf, dass es Ratten, Mäusen und Co. den Umständen entsprechend gut gehe.