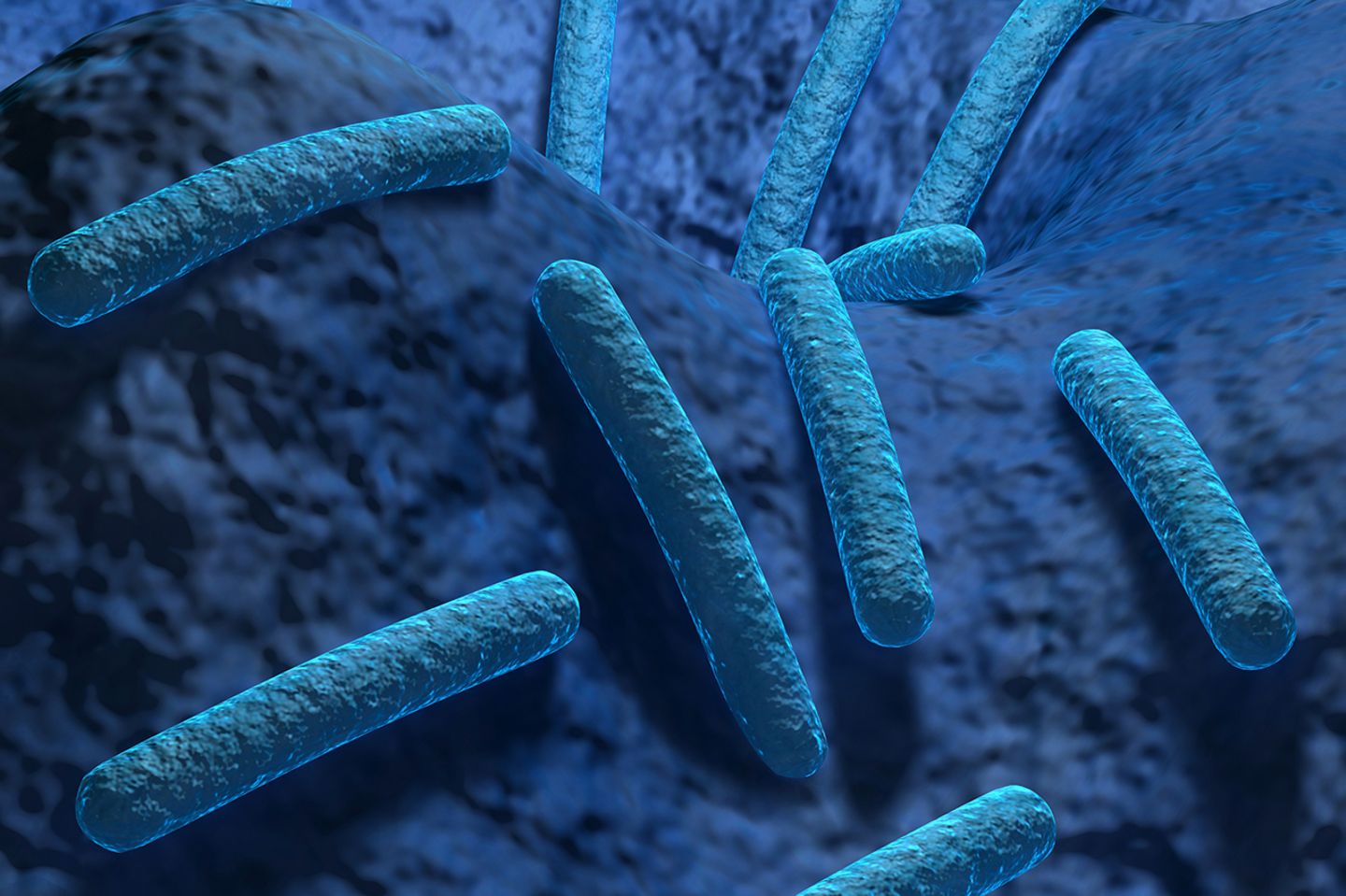Der äußere und innere Schutzwall
Haut, Nasenhaare und Schleimhäute, etwa in Nase, Mund und Lunge, schirmen unseren Körper gegen Bakterien und andere Eindringlinge ab. Dazu kommen weitere Barrieren wie Spucke und Magensäure. Sie machen Keime unschädlich, die mit der Nahrung in unseren Körper kommen.
Schnelle Eingreiftruppe
Gelangen dennoch unerwünschte Bakterien in den Körper, greift innerhalb von Minuten unsere natürliche Abwehr ein: die Fresszellen. Makrophagen zum Beispiel vertilgen die Angreifer, und bestimmte Granulozyten vergiften sie. Dieser Teil des Immunsystems ist uns angeboren. Dass und wie die Fresszellen arbeiten, merken wir nicht.
Intelligente Spezialeinheit
Bakterien, die von der natürlichen Abwehr nicht vollständig vernichtet wurden, bekämpft die spezifische Abwehr. Das merken wir: Wir werden krank. Dieser Teil des Immunsys ems braucht ein paar Tage, um zu starten: Dendritische Zellen erkennen und verschlingen die Angreifer und informieren sogenannte T-Zellen. Diese vermehren sich schlagartig
und greifen den Feind gezielt mit Zellgiften an.
Dazu aktivieren sie ihre Verbündeten, die B-Zellen, die Antikörper produzieren. Deren Job: Sie heften sich an die fremden Bakterien, um sie als Feinde zu markieren. So erkennt und merkt sich das Immunsystem den Erreger. Dringt dieser später noch einmal in den Körper ein, bleibt sein Angriff wirkungslos – das Immunsystem hat ihn sofort im Griff, der Körper ist gegen ihn immun.
Verstärkung von außen
Versagt unser Immunsystem im Kampf mit Bakterien, verschreiben Ärzte oft ein Antibiotikum. Dies ist ein Stoff, der aus Pilzen, Bakterien oder im Labor künstlich hergestellt wird und Bakterien am Wachsen hindert. Antibiotika nehmen wir meist als Tabletten ein.
Sich unangreifbar machen
Mit einer Impfung können wir Menschen uns gegen bestimmte Bakterienangriffe wappnen. Dabei wird der Körper gezielt mit einer abgeschwächten Form des Bakteriums infiziert, sodass die spezifische Immunabwehr den Feind kennenlernt und der Mensch dadurch immun wird.