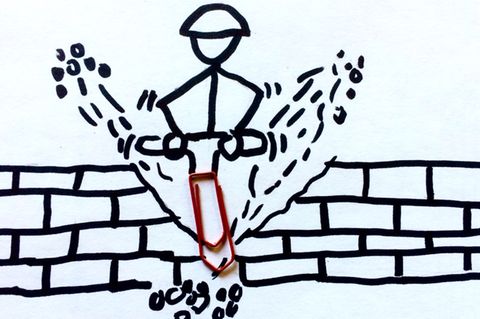Barbarazweige aufstellen
Nach einem alten Brauch werden am 4. Dezember, dem Tag der heiligen Barbara, einige Zweige eines Kirschbaums geschnitten und im Haus in die Vase gestellt. Mit genügend frischem Wasser öffnen sich die Winterknospen pünktlich zum Weihnachtstag und bescheren ihrem Besitzer zum Fest ein kleines Blütenwunder und Glück für das nächste Jahr.
Die Tradition geht auf die Geschichte der Kaufmannstochter Barbara zurück. Sie lebte um 300 nach Christus in der Türkei und wurde aufgrund ihres christlichen Glaubens zum Tode verurteilt. Als man Barbara in den Kerker zerrte, verfing sich in ihrem Kleid ein Kirschbaumzweig. Mit ein paar Tropfen Wasser aus ihrer Trinkschale hielt die spätere Heilige den Zweig am Leben, der ihr in ihren letzten Tagen Trost spendete. Genau am Tag ihrer Hinrichtung öffneten sich dann die Kirschblüten, so die Sage.

Wie ist das möglich? Viele Laubbäume tragen in der kalten Jahreszeit Winterknospen. Das sind junge, unentwickelte Triebe mit vorgebildeten Blättern oder Blüten, die durch sogenannte Knospenschuppen gegen die Kälte geschützt sind. Im Frühjahr, wenn es wärmer wird, treiben die Knospen aus. Dann fallen die Knospenschuppen ab und hinterlassen an den Trieben ringförmige Narben.
Stellt man die Zweige Anfang Dezember ins Haus, gaukelt die Zimmerwärme ihnen Frühlingstemperaturen vor. In den drei Wochen bis Weihnachten sammeln die Knospen exakt die Wärmesumme, die ihnen im Frühjahr sonst den biologisch richtigen Zeitpunkt zum Austreiben anzeigt. In der Natur merkt der Baum vor allem an der Tageslänge, wann er austreiben muss.
Wenn ihr die Barbarazweige schneidet, solltet ihr sie über Nacht zunächst in warmes Wasser legen. Erst dann kommen sie in die Vase, deren Wasser alle drei bis vier Tage gewechselt werden muss. Achtung mit der Temperatur: Zuviel Wärme lässt die Zweige austrocknen, deshalb stellt den Strauß nicht direkt neben die Heizung.
Schneemänner bauen - mal anders
Schon vor Hunderten Jahren erwiesen sich die Menschen als echte Hochstapler – und bauten erste Schneemänner, Kugel für Kugel für Kugel. Seitdem haben sich viele verschiedene Schneemannarten entwickelt. Wir zeigen euch lustige Ideen, wie ihr außergewöhnliche Schneemänner bauen könnt.

Sternegucken am Winterhimmel
Der Dezember bringt die längsten Nächte des Jahres, fast zwölf Stunden lang ist es draußen nun dunkel. Beste Voraussetzungen für Sternengucker, denn in klaren Nächten bietet der Winterhimmel die hellsten Sterne und die auffälligsten Sternbilder.
Dadurch, dass die Erde sich im Jahr einmal um die Sonne dreht, sehen wir zu jeder Jahreszeit einen anderen Himmelsabschnitt. Im Frühjahr oder Sommer sind andere Sterne sichtbar als im Herbst oder Winter. Viele dieser Sterne sind sogenannte Fixsterne. Das sind ferne Sonnen, die an einem festen Punkt am Himmel zu stehen scheinen. Denkt man sich zwischen bestimmten Sternen Linien, ergeben sich die Sternbilder.
Schon vor 4000 Jahren haben die Menschen in die Sterne geguckt und sie in Bilder aufgeteilt. Überall auf der Welt gab es jedoch unterschiedlicher Sternbilder, da die einzelnen Kulturen sich alle eigene Figuren ausdachten. Inzwischen geht man von 88 Bildern aus, auf die sich die Astronomen weltweit geeinigt haben. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich eigene Gebilde am Himmel suchen.
Wie der Sternenhimmel im Dezember aussieht, seht ihr auf der Internetseite des Planetarium Hamburg.

Wer zum ersten Mal die Sterne ansieht, hat meist Probleme, sich in den ganzen funkelnden Punkten zu orientieren. Es hilft, zunächst den "Großen Wagen" zu suchen, ein Teil des Sternbilds "Großer Bär". Die Sterne des Großen Wagens sind alle ähnlich hell, sie bilden zusammen ein Viereck, an das sich drei Sterne anschließen, die den Griff des Wagens bilden. Diese Sterngruppe kann euch die Richtung zu weiteren Sternbildern zeigen, nehmt dafür am besten eine Sternkarte zur Hilfe.
Besonders unter den Winterbildern sind in südlicher Richtung die sechs Sternbilder, die zusammen das Wintersechseck bilden: Ganz im Westen steht der "Stier" und darunter der markante "Orion", der in der Mitte von den sogenannten Gürtelsternen zusammengehalten wird. Unsere Vorfahren sahen in dem Bild einen Jäger, weshalb sie den Orion "Himmelsjäger" tauften, über den es viele Sagen und Geschichten gibt.
Weiterhin gehören zum Wintersechseck der "Kleine und der Große Hund" sowie die "Zwillinge" und der "Fuhrmann". Die hellsten Sterne dieser Bilder ergeben zusammen ein Sechseck, das Ende Dezember um Mitternacht in seiner höchsten Position am südlichen Himmel steht. Könnt ihr es entdecken?
Tierbeobachtung: Felländerung im Winter
Einige Tiere passen sich der kalten Jahreszeit nicht nur mit einem wärmeren Fell an, sondern wechseln zum Winter auch die Farbe ihres Gewandes und werden schneeweiß. Dazu gehören zum Beispiel das Alpenschneehuhn und der Schneehase, die wir in den Alpenregionen beobachten können, oder der Polarfuchs, auch Eisfuchs genannt, der in Nordeuropa, Nordrussland oder Kanada zu Hause ist. Im Schnee sind sie mit ihrem weißen Kleid bestens getarnt.

Bei uns in Deutschland wohnt ein weiterer Vertreter der tierischen Tarnungskünstler, der Hermelin. Auch er ist perfekt an den Wechsel der Jahreszeiten angepasst. Im Sommer ist sein Fell zimtbraun, im Winter wird er bis auf die schwarze Schwanzspitze weiß.
Hermeline sind Raubtiere, gehören zur Familie der Marder und sind auf der Nordhalbkugel weit verbreitet. Wie alle Marder haben sie einen langen schlanken Körper. Ausgewachsene Tiere werden etwa 30 bis 40 Zentimeter groß. Hermeline meiden dichte Wälder, genau so wenig behagen ihnen offene Flächen, da dort die Gefahr zu groß ist, von Greifvögeln entdeckt zu werden. Am liebsten halten sie sich in Wiesen- und Ackerlandschaften auf. Auch in der Nähe von Siedlungen kann man Hermeline oft beobachten, wo sie nach Nahrung und Verstecken suchen. Die Tiere sind sowohl tag- als auch nachtaktiv, meist beginnen sie mit der Dämmerung ihre Jagd nach Mäusen, Vögeln oder Insekten.
Der Farbwechsel des Hermelinfells wird von der inneren Uhr der Tiere bestimmt. Im Herbst fallen die braunen Haare aus und es wachsen dickere weiße Haare nach. Das passiert allerdings nur bei den Hermelinen, die nördlich der Alpen wohnen. Tiere, die im wärmeren Süden zu Hause sind, wo nur sehr selten Schnee fällt, bleiben das ganze Jahr braun. Ein weißes Fell würde für sie keine Tarnung bedeuten.
Da in den meisten Regionen Deutschlands jedoch nicht mit Beginn des Winters der erste Schnee fällt, kann man Hermeline am Winteranfang besonders gut beobachten. Denn bis der Schnee kommt, setzen sie sich mit ihrem weißen Fell besonders gut von der braunen und grünen Landschaft ab. Wie wäre es also mit einem kleinen Spaziergang? Vielleicht könnt ihr dabei einen Winter-Hermelin erspähen.