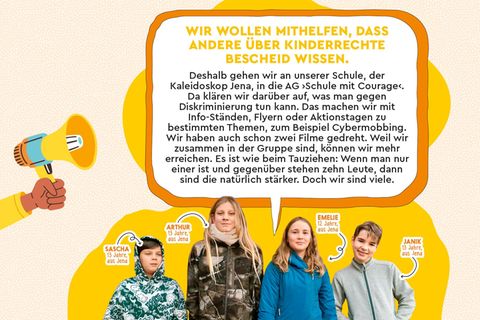Lukian ist ein Macho. Und was für einer! „Wer etwa Frauen sähe, wie sie am Morgen aus dem Bett kommen, der würde sie hässlicher finden als Affen“, lästert der Schriftsteller. Und weiter: „Darum schließen sie sich sorgfältig zu Hause ein und sind für kein männliches Wesen sichtbar. Alte Weiber und eine Schar von Dienerinnen stehen um sie herum und bearbeiten ihre Unglücksgesichter. Puder in verschiedenster Zusammensetzung müssen die unerfreuliche Gesichtsfarbe aufhellen. Da sind silberne Schüsseln, Krüge, Spiegel, eine Menge von Büchsen wie in einer Apotheke, Gefäße voll von heillosem Zeug, in denen Zahnputzmittel oder Farben zum Schwärzen der Augenlider bereitgehalten werden.“
Mal ehrlich: Für diese Zeilen hätte der Mann eine schallende Ohrfeige verdient! Allerdings können wir ihn nicht mal mehr mit einem bösen Blick strafen – Lukian lebte im 2. Jahrhundert nach Christus.

Und manche Wissenschaftler vermuten gar, er habe diese Frechheiten noch nicht mal selbst verfasst. So oder so aber verraten die spottenden Worte so einiges: erstens, dass Kosmetik schon in der Antike angesagt war. Zweitens, dass sich römische Frauen nur dann schminkten oder besser: schminken ließen, wenn sie unbeobachtet waren. Drittens erfahren wir, dass blasse Haut als schick und vornehm galt. Und viertens, dass es schon vor rund 1800 Jahren allerlei Schnickschnack gab, mit dem man das Gesicht bearbeiten konnte, sollte oder wollte. „Schönheitspflege spielte bei den Römern spätestens ab der Kaiserzeit eine große Rolle“, bestätigt die Archäologin Gisela Michel.
Vorbehalten war das Schminken, Spachteln, Pudern und Tupfen freilich den Wohlhabenden. Eine ordentliche Gesichtsbehandlung kostete schließlich nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld. Als Make-up-Grundlage trugen die Damen Roms eine pudrige Paste auf, die griechische Sklavinnen, die sogenannten Kosmeten, aus Fett oder Honig und Kreide oder gar aus giftigem Bleioxid zusammenmischten. Ein wenig purpurfarbenes Rouge peppte die weißen Wangen auf. Lider und Wimpern schwärzten die Frauen mit Asche oder Ruß, bisweilen setzten sie mit einem zarten Blau Farbakzente.
Anders als Lukian begrüßte sein Kollege, der römische Dichter Ovid (43 v. Chr. bis 17 n. Chr.), diese kosmetischen Kunststücke: „Cura dabit faciem“, schrieb er. Das bedeutet so viel wie: „Pflege wird deinem Gesicht Schönheit verleihen.“ Und er fand nicht nur salbungsvolle Worte: In seinem Werk „Ars amatoria“ – der „Liebeskunst“ – lieferte Ovid auch Rezepte für Gesichtsmasken und Mundspülungen und legte seinen Leserinnen Reinlichkeit ans Herz. Schließlich könne selbst das hübscheste Antlitz nicht von unangenehmem Schweißgeruch ablenken – den Ovid mit dem Gestank eines Ziegenbocks verglich.
Und so zog es die Römer, Frauen wie Männer, spätestens am Abend scharenweise in die meist öffentlichen Thermen. Diese Badehäuser in den Städten besuchten Menschen aller Gesellschaftsschichten, manche planschten sogar täglich! „Es gab einfache Anlagen, aber auch edle Paläste, an denen sich heutige Saunalandschaften nicht messen können“, sagt Gisela Michel. Mit ihren riesigen Kuppeldächern, den marmornen Säulen und Statuen sahen die Schwimmbäder aus wie Kathedralen oder Tempel. Manche Thermen waren sogar mit Bibliotheken ausgestattet, andere mit Kegelbahnen, und auch Musiker und Artisten traten auf.
Doch zurück zum eigentlichen Bad – das Stunden dauern konnte! Kompliziert war schon der „Vorwaschgang“. Da die Römer keine Seife kannten, rieben sie sich zunächst von Kopf bis Fuß mit Olivenöl ein. Das band den Schweiß und Schmutz am Körper. Mit einem gebogenen Metallteil, der strigilis, ließen sie hernach den Dreck wegschaben. Erst dann starteten sie ihr Wechselbad. Station Nummer eins war das tepidarium, ein Becken mit lauwarmem Wasser, auf das Station Nummer zwei folgte, das caldarium. In diesem „Kochtopf“ war das Wasser 40 Grad Celsius heiß. Danach stieg man – Station Nummer drei – in den coolen Pool des frigidarium. Und wer das Bad in der Menge nicht schätzte, der zog sich entweder in eine Einzelwanne zurück oder brachte seinen Kreislauf im sudatorium in Schwung, dem Vorläufer unserer Sauna (siehe Kasten unten). Manch ein Genießer schob noch eine Massage hinterher. Kein Zweifel, von Wellness verstanden die Römer eine Menge.
Dann aber begann der unangenehme Teil des Thermenbesuchs – die Entfernung der Körperhaare. In der Kaiserzeit gab man aalglatten Typen den Vorzug. Es war zum aus der Haut fahren! Entweder rupften Epilierer die Härchen mit einer Pinzette auch aus so empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen. Oder sie bestrichen Leinentücher mit einer Paste aus Baumharzen, die sie auf Beine und Arme legten – und mit einem Ruck wieder abzogen. Bei diesen Torturen, heißt es, gellten Schmerzensschreie durch die Bäder.
Da half schlussendlich nur noch eines: Parfüm. Das stellten die alten Römer nämlich nicht wie wir heute auf Basis von Alkohol her. Denn der hätte auf der gereizten Haut gebrannt wie Feuer. Als Grundstoff nutzten sie vielmehr das Fett öliger Früchte, etwa von Oliven, Nüssen oder Mandeln, das sie mit Rosenblüten, Kräutern und teils teuersten Gewürzen wie Safran parfümierten (siehe Kasten linke Seite). Damit salbten sie ihren Körper und schmierten es für den ganz besonderen Glanz sogar ins Haar.
Lucius Verus (130 bis 169 n. Chr.), Mitkaiser von Marc Aurel, soll diesem Kult die Krone aufgesetzt haben: Da er keinen Schimmer hatte – zumindest nicht in seiner Lockenpracht –, bestäubte er den blonden Schopf mit Goldpuder. So mag er zwar nicht wie ein Affe ausgesehen haben, lieber Lukian. Affig benommen hat sich der eitle Zeitgenosse aber auch!