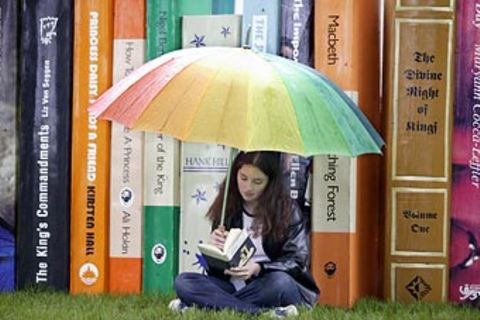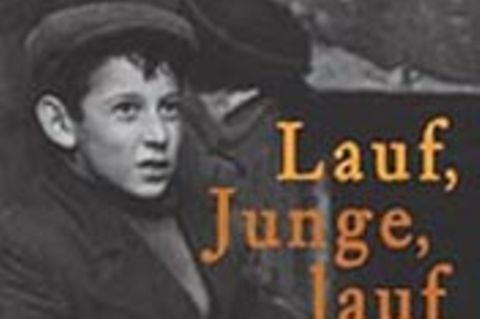"Los, anziehen, nichts mitnehmen. Lass alles liegen. Los, los, los!" Hastig stopft die Mutter Geld und Schmuck in eine Aktentasche. Ihre dunkelbraunen Augen flackern. Der Lärm der Straße dringt durch das Fenster: Das Klackern eisenbeschlagener Stiefel auf Pflastersteinen. Schreie. Gebrüll. In Windeseile schlüpft Michael in Jacke und Mantel.
Mit einem Ratsch reißt ihm die Mutter die gelben Davidsterne von der Kleidung. Dann eilen sie zur Tür, zum Fahrstuhl: Nichts wie raus! März 1943, der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange. Längst prägen Verbote, Zwangsarbeit und Schikanen den Alltag der Juden in Deutschland. Vor allem aber verschwinden immer mehr von ihnen.
Im Nationalsozialismus ist das Leben für Juden die Hölle
Wie an diesem Tag im März, mitten in Berlin. Unsanft treiben die Männer der Schutzstaffel (SS) Michaels jüdische Nachbarn aus ihren Wohnungen auf die Eisenacher Straße hinaus. Der Elfjährige greift nach der Hand seiner Mutter. Jetzt bloß nicht auffallen! Ziellos laufen die beiden durch das Stadtviertel.
Sie sehen, wie Männer, Frauen und Kin der auf die Ladeflächen von Lastwagen geschubst werden – und versuchen, so teilnahmslos wie möglich zu wirken. Vier, fünf Tage verbringen sie auf der Straße. Nachts schlafen sie in Treppenhäusern. "Irgendwie hatten wir die Kraft dazu", sagt Michael Degen heute, 65 Jahre später, "Mutter vor allen Dingen."
Deportationen in Konzentrationslager
Seit Ende 1938 wird das Leben der Juden in Deutschland zur Hölle. Überall müssen sie mit Schikanen rechnen. Viele werden in Konzentrationslager (KZ) gebracht. Ab 1941 muss außerdem jeder Jude den gelben Davidstern als Erkennungszeichen tragen.
Dass sie untertauchten, hat Michael und seiner Mutter Anna das Leben gerettet. Nach Schätzungen von Historikern versteckten sich wäh rend des Krieges rund 7000 Juden auf diese Weise in Berlin, um den Deporta tio nen zu entgehen. "U-Boote" nannten sie sich selbst und erfanden neue Namen und Lebensgeschich ten. Aus Michael und Anna Degen werden so Max und Rosa Gemberg.
Diese Namen hat sich Lona ausgedacht, eine Freundin der Familie. Eine halbe Ewigkeit laufen ihr Michael und Anna jetzt schon hinterher, kreuz und quer durch Berlin: Spuren verwischen! Lona hat 1938 das Geschäft von Michaels Vater Jacob übernommen, das er als Jude nicht mehr führen durfte.
Seither teilt sie – heimlich – ihre Einnahmen mit den Degens. "ne Rieseneinkaufstasche mit was zu futtern habe ich dabei", sagt sie stolz. Das Beste aber: Über ihren Bekannten Hotze hat sie eine Unterkunft für "Max" und "Rosa" aufgetrieben: die Dienstbotenzimmer der russischen Konzertpianistin Ludmilla Dimitrieff. Endlich stehen sie vor dem Haus in der Hektorstraße. Es ist das erste von acht Verstecken in den kommenden zwei Jahren.

- Von einer Deportation spricht man, wenn Menschen zwangsweise an einen anderen Ort gebracht werden – und das aufgrund einer staatlichen Anordnung. Während des Krieges wurden beispielsweise die Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt.
Rettung in "U-Booten"
Die wenigsten "U-Boote" bleiben lange an einem Ort. Manche Überlebende des Holocaust erzählen von mehr als 50 Stationen! Immer wieder sind sie auf Menschen angewiesen, die den Mut haben, ihnen zu helfen. Menschen wie Hotze und Lona. Sie besorgen Lebensmittel und finden neue Verstecke.
Denn lange Zeit können Michael und Anna nicht bei Ludmilla bleiben: Im Bombenhagel wird deren Wohnung zerstört. Bei der schnodderi gen Oma Teuber finden die Degens nun zwar Quartier, doch der Sohn, ein überzeugter Nazi, schmeißt sie raus. Wieder geht es weiter - in eine Laubenkolonie im Stadtteil Neukölln.
Oft friert Michael, oft hat er Hunger. "Lachen ist wichtiger als Essen", sagt die Mutter. Aber ihre Augen verraten, dass sie kurz vorm Zusammenbrechen ist. Dann endlich hat Ludmilla eine neue Wohnung und nimmt die beiden wieder auf. Bis Anna beinahe verhaftet wird. Die Luft ist klirrend kalt an diesem Februartag 1944.
Als Mutter und Sohn auf die Straße treten, frösteln sie am ganzen Leib. "Hol mir doch noch einen Schal von Ludmilla", bittet Anna und Michael spurtet los. "Als ich wieder herunterkam, stand sie da mit einem Herrn. Ich dachte: Woher kennt sie den? Dann sah ich, wie sie kaum merklich winkte. Wir waren eingespielt: Ich wusste sofort, ich soll verschwinden!"
- Das Wort Holocaust stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Brandopfer". Heute wird damit der Völkermord an den Juden während der NS-Zeit bezeichnet. Bis zu sechs Millionen Juden wurden damals ermordet, vor allem in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Weil ihre Leichen verbrannt wurden, wird dieses schlimme Verbrechen Holocaust genannt.
Der Schock sitzt tief
Was war mit Anna geschehen? Immer wieder läuft Michael zum S-Bahnhof Bellevue - dem Treffpunkt, den sie für brenzlige Situationen ausgemacht hatten. Von der Mutter aber fehlt jede Spur. Die Angst kriecht durch Michaels Körper. Es wird dämmrig. Dann finster.
Erschöpft lässt sich der Junge in einen Hausflur fallen, er weint. Ein letztes Mal nimmt er seine Kraft zusammen und schleppt sich zum Bahnhof. Auf halbem Weg kommt ihm seine Mutter entgegen.
Sie war in eine Kontrolle der Gestapo geraten und hatte nicht mehr dabei als einen abgelaufenen - und obendrein gefälschten - Ausweis. Und ihr freches Mundwerk: Empört redete sie auf den Beamten ein. Was ihm denn einfalle. Man könne ja zur Polizei gehen und die Sache klären. Genau das hätte ihr Ende bedeutet.
Aber ihre Überzeugungskraft wirkte Wunder, Anna durfte gehen. Bei Ludmilla bleiben können die Degens jetzt allerdings nicht mehr. Die Gefahr, erkannt zu werden, ist zu groß. Wieder sind sie auf der Flucht.
- Aufgabe der Geheimen Staatspolizei Gestapo war es, vermeintliche politische Gegner der Nazis aufzuspüren und in Haft zu nehmen.
1945: Die Befreiung
Im April 1945 schließlich leben Michael und Anna im Berliner Vorort Kaulsdorf bei Hotzes Schwägerin Martchen, "einer grundgütigen Frau, einem Engel, mit Riesennase und Dutt". Als die Russen, die zu den Alliierten gehören, Berlin angreifen, sitzen sie zu dritt im Bunker. Die Granaten heulen. Dann ist plötzlich Stille.
"Wir müssen sehen, was draußen los ist", ruft Martchen. Aus der Ferne sind Motorengeräusche zu hören. Russische Panzer, die Befreier! Kaum später poltert es an der Tür: "Aufmachen!" Brutal drängen die Soldaten die Frauen beiseite. "Das sollen unsere Befreier sein?", schreit Michael.
Dann begreift er: Die Russen glauben, sie wären Nazis - und keine Juden! Hektisch redet Anna auf Russisch auf einen Offizier ein, der sich plötzlich auf Deutsch an Michael wen det: "Dein Vater ist also gestorben? Weißt du, was du als Jude tun musst, wenn dein Vater gestorben ist?"
"Das Totengebet", stammelt Michael. "Sag es jetzt!", fährt ihn der Russe, selbst ein Jude, an. Hastig leiert der Junge die Verse herunter. Der Offizier beginnt zu weinen. Nach zwei Jahren auf der Flucht rettet das Totengebet Michael und Anna Degen das Leben.
- Als Alliierte bezeichnet man die gegen Nazi-Deutschland verbündeten Staaten, vor allem die USA, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich.