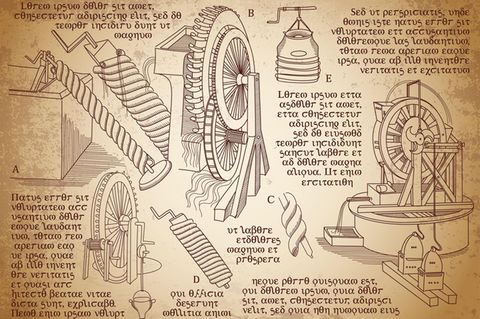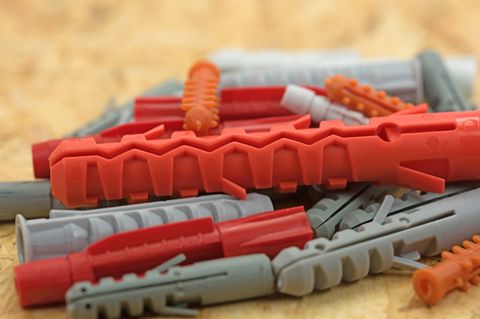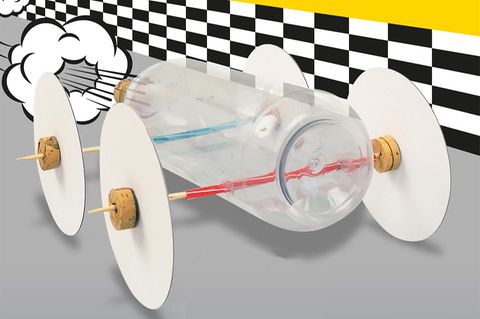Die Ampel wird rot. "Leonie" schaltet einen Gang runter, bremst und hält an. Bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h soll sie auf der zweispurigen Fahrbahn die Spur halten, Kreuzungen und Hindernisse beachten sowie Abstände und Geschwindigkeiten einhalten. Im Auto sitzen Beobachter. Darunter ein Sicherheitsfahrer, der notfalls eingreifen kann. Trotzdem hat "Leonie" keinen Prüfungsstress, denn sie ist kein Mensch. "Leonie" ist ein Auto - unterwegs als automatisches Testfahrzeug der Technischen Universität (kurz: TU) Braunschweig.
"Leonie" - ein umgebauter VW Passat - ist nur ein intelligentes Auto von vielen. Schon länger wird weltweit in den Laboren und auf Testgeländen auf vollen Touren geforscht. Einige Projekte feierten in diesem Jahr ihre ersten Triumphe. So verkündete das Unternehmen Google erst kürzlich, dass es eine ganze Flotte von autonomen Fahrzeugen betreibt, die es erfolgreich auf Kaliforniens Straßen testet. Ein italienisches Team der Universität Parma ist mit zwei intelligenten Autos von Italien nach China gefahren, wo sie in Schanghai kurz vor dem Ende der Weltausstellung 2010 eintrafen. Am Ziel verkündeten die Forscher stolz, dass sie auf der 13.000 Kilometer langen Strecke nur selten eingreifen mussten.
Grünes Licht für Leonie
Doch während das italienische Duo oft auf einsamen Pisten entlang rollte, hat das Projekt "Stadtpilot" der TU Braunschweig nicht nur das Vorwärtskommen im Sinn. "Unser Ziel ist, dass "Leonie" unabhängig von Menschen im Stadtverkehr selbst fahren kann", erklärt Professor Maurer, Leiter des Instituts für Regelungstechnik der TU Braunschweig. Eine große Herausforderung, denn der dichte Stadtverkehr, die schmalen Straßen und die enge Bebauung erschweren eine genaue Autoführung. Außerdem hat das computergesteuerte Fahrzeug mit vielfältigen Teilnehmern zu tun: Fußgänger, die unerwartet über die Straße laufen, unachtsame Autofahrer oder waghalsige Radfahrer. Deshalb reicht es nicht, dass der Computer im Wagen nur die Verkehrsregeln beherrscht. Er muss ebenfalls seine Umwelt gut beobachten und jederzeit richtig reagieren können.
Laser, Scanner und Sensoren
Dazu wurden in "Leonie" Sensoren eingebaut, also Messgeräte, die Informationen aus der Umgebung sammeln und auswerten können. Ein Navigationssystem hilft dem Wagen seine genaue Position zu berechnen. Laserscanner auf dem Dach und Radarsensoren im Front- und Heckbereich sorgen für einen 360° Rundumblick.
Zur besseren Organisation des Verkehrs werden im Braunschweiger Stadtgebiet Messgeräte und Kommunikationspunkte aufgestellt, die mit dem Verkehrscomputer verbunden sind. An diesen Stationen kann ein autonomes Fahrzeug zukünftig abfragen, wie die momentane Verkehrslage aussieht. Nur dann funktioniert der Gebrauch im Stadtverkehr.
Bisher hat das Team um "Leonie" eine Genehmigung für Testfahrten, die sich auf den Braunschweiger Ring beschränkt. Nächstes Jahr soll Leonie nach Baden-Baden fahren. Darauf muss sich das Team erst vorbereiten. "Wenn die Genehmigungen stehen, spricht nichts dagegen, dass Leonie auch in Hamburg oder München fährt", sagt der Professor zuversichtlich.
Mit Autopilot in Richtung Zukunft
Die Forschung verfolgt mehrere Ziele: Der Wagen soll effizienter, komfortabler und sicherer werden.
"In der Zukunft werden die Fahrzeuge auch untereinander Informationen austauschen", sagt Professor Maurer. Sie wissen, wo sich die anderen Autos befinden und was sie vorhaben. Auf diese Weise können sie die optimale Route und Geschwindigkeit berechnen. Das Stehen im Stau oder das Warten an roten Ampeln sollen dann der Vergangenheit angehören. So spart der Passagier nicht nur Zeit sondern auch Sprit. Die Forscher gehen davon aus, dass die Straßen durch die optimale Raumnutzung - im Vergleich zu heute - doppelt soviel Verkehr fassen könnten.
Autonome PKWs richten sich an diejenigen, die entweder nicht selber fahren wollen oder können. "Für ein Auto der Zukunft braucht man keinen Führerschein", erklärt Professor Maurer. Es wird so einfach zu bedienen sein, dass es auch Kinder, alte und kranke, ja sogar blinde Menschen problemlos alleine nutzen können. "Der Wagen funktioniert wie ein Taxi - nur eben ohne Taxifahrer", so der Wissenschaftler.
Viele Verkehrsunfälle entstehen heute, weil Autofahrer Fehler machen oder das Verhalten der anderen Teilnehmer falsch deuten. Die Robotik-Experten glauben, dass viele davon mit intelligenten Autos vermeidbar wären. Denn im Vergleich zum Menschen ist ein Computer nie müde, gestresst oder abgelenkt.

Schritt für Schritt
Schon heute werden Systeme eingesetzt, die den Fahrer unterstützen. So helfen zum Beispiel sogenannte Bremsassistenten bei drohendem Zusammenstoß, den Anhalteweg zu verkürzen. Für diesen Moment übernimmt der Computer die Kontrolle. "Unser Ziel ist, diese Zeiträume auszudehnen. Bis fahrerlose Autos über unsere Straßen sausen, wird es aber noch gute 20 Jahre dauern", schätzt der Experte. "Dass Autos sich selbständig in eine Parklücke lotsen, wird technisch bereits in fünf Jahren möglich sein."
Bei jedem Schritt steht die Sicherheit an oberster Stelle: Erst wenn die Wissenschaftler das Unfallrisiko fast ausschließen können, werden uns die selbständigen Autos im Alltag begleiten können. Doch bis dahin, sind noch viele Testfahrten nötig.