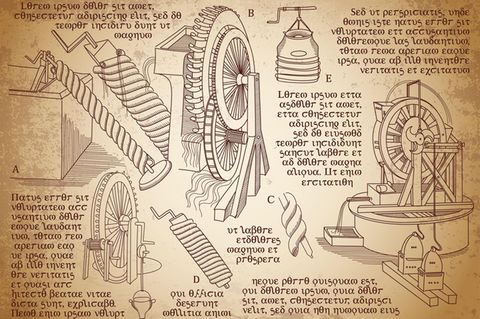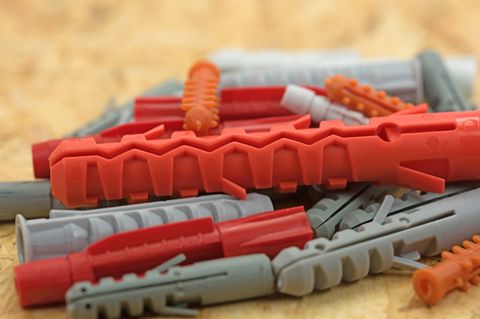Mathias Kahmke sitzt an seinem Arbeitstisch, als machte er einen Sehtest beim Augenarzt. Den Rücken kerzengerade durchgestreckt, blickt er durch ein mächtiges Vergrößerungsglas, eine Art Riesenlupe. Darunter: seine Hände, die einen winzigen Stichel halten, und ein rundes Stück Metall. Behutsam ritzt er die Linien in dessen Oberfläche nach. "Gleichmäßig müssen sie sein", murmelt er und führt den Stichel über das Metall, auf dem das Bild eines Adlers mit ausgebreiteten Schwingen prangt. Es ist der wohl bekannteste Adler im ganzen Land - der Bundesadler. Sein Bild schmückt die Rückseiten der deutschen Ein- und Zwei-Euro-Münzen. Und genau dafür sorgt, unter anderem, Mathias Kahmke: Er ist Graveur bei der "Hamburgischen Münze", einer der fünf Münzstätten in Deutschland. In diesen "Geldfabriken" werden seit Jahrhunderten Münzen hergestellt, in Hamburg schon seit dem Jahr 834. Damals durfte der Erzbischof der Stadt erstmals das kaiserliche Münzrecht ausüben - er bekam also die Erlaubnis, Münzen zu fertigen. Heutzutage stünde dem Kirchenmann der Mund vermutlich sperrangelweit offen, würde er die Hamburgische Münze besuchen: Bis zu 800 Millionen Geldstücke werden hier jährlich geprägt, 850 Münzen pro Maschine und Minute!

Genauigkeit bis ins kleinste Detail

Natürlich graviert Mathias Kahmke die nicht alle einzeln per Hand, das wäre schließlich eine Heidenarbeit. Und trotzdem: Ohne den 40-Jährigen bliebe unser Geld gesichtslos. Denn Mathias Kahmke stellt die sogenannte Patrize her, den "Ur-Stempel" für die eigentlichen Münzstempel. Die Produktion einer jeden Patrize - einem Einzelstück übrigens - beginnt in einem kleinen Raum, unweit von Mathias Kahmkes "Stichelzimmer". Das Surren der Maschinen füllt hier jeden Winkel. Im hinteren Teil des Raumes tastet ein Laser das esstellergroße Gipsmodell einer Münze ab. Jeder Strich, jede Ecke, jedes noch so kleine Detail der Vorlage wird auf diese Weise vermessen und in einen Computer übertragen. "Das dauert zwischen zwölf und 20 Stunden", sagt der Graveur. Und das ist bloß der Anfang. Schließlich muss das Motiv danach auf dem stählernen Patrizenkörper verkleinert abgebildet werden. Dies geschieht in einer Fräsmaschine mit einem Stichel, der etwa so dünn ist wie ein menschliches Haar. Stunde um Stunde kreiselt er spiralförmig über das Metall und graviert das Bild dort hinein. Winzige Späne fliegen; aus kleinen Düsen spritzt Öl auf den Fräser, damit er nicht überhitzt. Je nach Größe und Motiv dauert eine solche Gravur ein bis zwei Tage. Dann landet die Patrize für die Feinstarbeit unter Mathias Kahmkes Lupe - zum Nachsticheln des exakten Abstands der Adlerflügel zum Beispiel. Jetzt noch mal in den Härteofen, dann ist der Metallkörper für seinen Job gestählt: Stempel herzustellen, die später auf Münzrohlinge donnern - der nächste Schritt im Produktionsablauf.
Auf der nächsten Seite erfahrt ihr, wie die Reise bis zur fertigen Münze weitergeht - und was vier Elefanten damit zu tun haben! Schon eine Idee?
Geprägt mit der Kraft von vier Elefanten
Diese Rohlinge, sogenannte Ronden, werden nicht hier gemacht, sondern von einer Spezialfirma geliefert. Sie lagern zunächst noch im Keller - einem riesigen, begehbaren Tresor, in dem auch schon fertig geprägte Euro-Stücke auf ihren Abtransport zur Deutschen Bundesbank warten. Gabelstapler düsen durch die Halle mit den dicken Türen und schichten Kisten über Kisten. Plötzlich rauscht es am anderen Hallenende gewaltig, als stünde man unter einem tosenden Wasserfall. Dabei füllt ein Mitarbeiter lediglich kupferfarbene Ronden in einen der Metallcontainer, die zum Transport innerhalb des Hauses genutzt werden. Dann endlich, im großen Prägesaal für Umlaufmünzen, wandeln sich die Rohlinge zu echten Geldstücken.


Über Stahlträgerbrücken gelangen sie in die zwölf grünen Prägemaschinen, wo sie buchstäblich der Schlag trifft: Mit dem Gewicht von mehr als 100 Tonnen - so viel Druck, als würden mindestens vier Elefanten auf eurem Fingernagel stehen - krachen die Stempel auf die Metallplättchen und drücken ihnen ihr Motiv auf: Bundesadler, Eichenzweig oder Brandenburger Tor. Die Vorderseite ziert jetzt der jeweilige Münzwert. Pro Sekunde spucken die Maschinen bis zu 13 Geldstücke aus ihrem Bauch. Frisch geprägt sind sie sogar noch warm. Damit zum nächsten Supermarkt flitzen, mit einer Handvoll Cent ein GEOlino- Heft am Kiosk kaufen oder gar den eigenen Lohn aus dem Container schöpfen, dürfen Mathias Kahmke und seine Kollegen allerdings nicht. Erst wenn die Deutsche Bundesbank die Münzen offiziell in Umlauf gibt, sind sie ein gültiges Zahlungsmittel. Und auch Langfinger haben in der Geldfabrik keine Chance: Wer Münzen aus dem Prägesaal schmuggeln will, bei dem piept's. Spätestens in der Sicherheitskontrolle.
Falschmünzen und der Klang des Geldes
Als der Süßwarenhändler José Martinez im spanischen Ávila vor Kurzem das Geld in seiner Kasse zählte, staunte er nicht schlecht: Ihm war eine Ein- Euro-Münze in die Hand gefallen, auf deren Rückseite nicht der spanische König Juan Carlos prangte. Sondern Homer Simpson! Diese Falschmünze mit dem Kopf der bekannten Comicfigur scheint zwar ein Einzelstück zu sein - Münzfälschung ist aber keine neue Erfindung. Schon vor rund 4000 Jahren fälschten Menschen Geld, indem sie aus Jade, Steinen oder Knochen Muschelschalen schnitzten, die als Zahlungsmittel dienten. Im Jahr 2007 zählte die Deutsche Bundesbank rund 82 000 Falschmünzen, darunter waren vor allem Zwei-Euro-Münzen. In Tokio hat nun ein japanischer Polizist eine Methode entwickelt, mit der man Falschmünzen am Klang erkennen kann. Wenn echte Münzen auf eine harte Oberfläche fallen, hört sich das nämlich anders an als bei falschen. Sein neu entwickeltes Computerprogramm zeichnet die Klangprofile der Geld stücke beim Aufprall so genau auf, dass "falsche Fuffziger" sofort entlarvt werden.