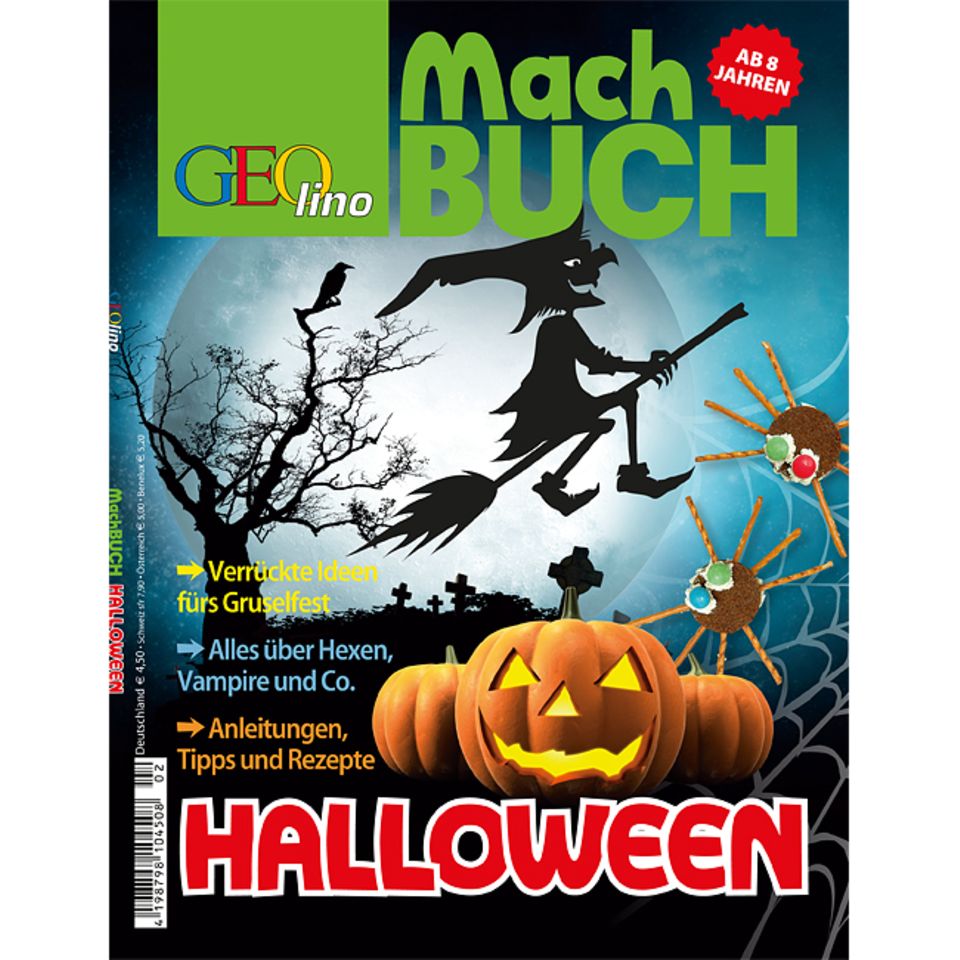Hexenverfolgung: Hexen als "Virus des Bösen"
Der Steckbrief in der "Neuen Zürcher Zeitung" klang wenig schmeichelhaft: Gesucht wird Anna Göldin, stand dort am 9. Februar 1782. Sie sei ungefähr 40 Jahre alt, schwarzhaarig,
ziemlich dick, mit ungesunden, rötlichen Augen. 100 Kronentaler Belohnung solle derjenige erhalten, der verrate, wo sich die Magd aufhalte. Denn Anna Göldin habe eine ungeheure Tat begangen.
Sie solle "in geheimer" und "fast unbegreiflicher" Weise einem achtjährigen Kind mit Nadeln zugesetzt haben. Mehr verriet der Artikel nicht. Doch die Leser begriffen auch so, was zwischen den Zeilen stand: Anna Göldin wurde als Hexe gesucht!
Eine Hexe? Das war den Richtern im Schweizer Kanton Glarus nicht geheuer. Den „Virus des Bösen“ kannte man in ganz Europa. Es hieß, Hexen würden nachts durch die Luft fliegen, den Teufel verehren, im Wald rauschende Feste feiern, kleine Kinder fressen und jeden, der ihnen in die Quere komme, mit Flüchen belegen. Und nun lag ihnen die Klage von Göldins ehemaliger Dienstherrin vor: Die behauptete, ihre Tochter spucke seit Kurzem Stecknadeln.
Und Göldin sei daran schuld. Die Magd musste unschädlich gemacht werden! Auf die gleiche Weise, wie vor ihr schon rund 70.000 Frauen, aber auch Männer aus ganz Europa als Hexen und Hexer verfolgt und hingerichtet worden waren. Ertränkt, auf Scheiterhaufen verbrannt, geköpft.
Hexenflug und Teufelspakt
Schon im frühen Mittelalter waren die Menschen überzeugt, dass dies alles Wirklichkeit war. Für sie stand außer Frage, dass es Männer und Frauen gab, die zaubern können und ihre Kräfte oft einsetzen, um anderen zu schaden. Starb einem Bauern die Kuh, glaubte er, jemand habe ihn verflucht. Ging die Ernte verloren, gab man einem "Schadenszauberer" die Schuld.
Woher sollten die Menschen es auch besser wissen? Lesen und schreiben konnten die wenigsten. Die Naturwissenschaften steckten noch in den Kinderschuhen. Niemand ahnte zum Beispiel, dass Krankheiten durch Viren oder Bakterien hervorgerufen werden.
Viele Gelehrte und auch Kirchenmänner bestärkten die Menschen in ihrem Irrglauben. Sonntags predigten die Priester von ihren Kanzeln, dass sich die Gläubigen vor Hexen schützen müssten! Wer immer eine verdächtige Beobachtung mache, sollte dies melden. Der Papst gab sogar einen Erlass heraus, nach dem Teufelsanhänger verbrannt werden sollten!
Den Höhepunkt erreicht die Hexenangst Ende des 16. Jahrhunderts
Einer, der mit seinem unermüdlichem Einsatz dazu beigetragen hatte, war Heinrich Kramer (1430–1505). Der Mönch aus dem Elsass säte Misstrauen, wo immer er auftauchte. Hexen seien nicht zu erkennen, hetzte er. Egal ob blond oder braunhaarig, jung oder alt – jeder Nachbar, jeder Freund könne zu den Teufelsanhängern gehören. Jeder Verdacht müsse deshalb gemeldet werden.
Als Kramer eines Tages die Einwohner von Innsbruck zur Hexenjagd anstacheln wollte, warf ihn der dortige Bischof aus der Stadt. Tief gekränkt, griff Kramer daraufhin zur Feder und schrieb im Jahr 1486 ein Buch, das Tausende Menschen das Leben kosten sollte. Sein Titel: "Malleus Maleficarum" - der "Hexenhammer".
Der Hexenhammer
Kramer kannte darin keine Gnade. Vor allem auf die Frauen hatte er es abgesehen. Sie seien besonders leicht vom Teufel zu verführen. Der Autor beschrieb genau, wie Hexen "entlarvt" werden: mit Folter! Die Hexenjäger rasierten daraufhin die Verdächtigen am ganzen Körper, schnitten ihnen die Nägel bis aufs Fleisch und quälten sie auf schlimmste Weise. Fielen die Opfer vor Schmerz in Ohnmacht, deuteten die Folterer dies als Beweis für den "Hexenschlaf".
Durch ihn, so behaupteten sie, schütze der Teufel seine Anhänger vor den Qualen. Zwar meldeten sich auch Kritiker, die solchen Verfolgungswahn für unsinnig erklärten. Kramers „Hexenhammer“ wurde trotzdem ein Bestseller – und schürte die Missgunst. Tausende Verdächtige mussten sich nun vor Gericht verantworten.
Oft steckte hinter Prozessen keine echte Hexenangst
Nicht selten zeigten Dorfbewohner oder Städter ihre Nachbarn bloß aus Neid, Ärger oder Hass an – einfach, um dem anderen eins auszuwischen. Zwar heißt es oft, dass Frauen, die als Hebammen arbeiteten, unverheiratet ein Kind bekamen oder sich mit Heilpflanzen auskannten, besonders viel Misstrauen erregten. Das ist jedoch nur eine Behauptung, der erst lange nach der Zeit der Hexenverfolgung in die Welt gesetzt wurde und sich hartnäckig hält. Denn tatsächlich konnte es jeden treffen – Reiche, Arme, Junge und Alte.
In Bürresheim, im heutigen Rheinland-Pfalz, trieben die Bewohnerinnen und Bewohner ihre gegenseitigen Verdächtigungen so weit, dass am Ende 51 Frauen und Männer unter Folter ihre angeblichen Verbrechen gestanden und hingerichtet wurden. Das war ungefähr ein Viertel aller Erwachsenen des Dorfes! Richter und Henker teilten sich dabei in Gedanken das Hab und Gut der Verdächtigen unter sich auf.
"Häufig sind die Richter schamlose, niederträchtige Menschen. Viele Beweise sind unzuverlässig und die Verfahren nicht selten gegen Gesetz und Vernunft", schimpfte 1631 der Priester und Professor Friedrich Spee, ein Gegner des Hexenwahns.
Doch diese Erkenntnis und der Kampf gegen den Aberglauben setzten sich nur langsam durch. Zu langsam für Anna Göldin. Sie hatte sich mit der Frau ihres Dienstherrn zerstritten und ihre Stelle verloren. Als kurz darauf deren kleine Tochter erkrankte, behauptete die Frau, Anna Göldin sei eine Hexe. Sie wurde gefasst, gefoltert und am 18. Juni 1782 mit dem Schwert hingerichtet. Anna Göldin starb als letzte "Hexe" Europas.
Dieser Artikel stammt aus dem "GEOlino Machbuch Halloween". Er wurde zuletzt am 10. August 2022 überarbeitet.