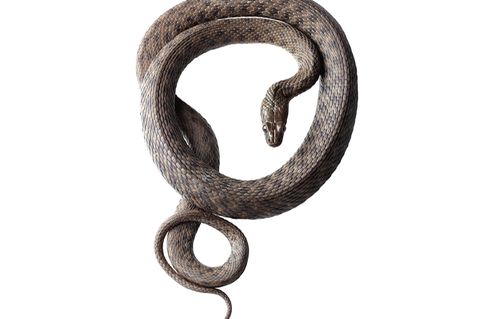Vom Aussterben bedroht
Die neue Bleibe ist wirklich nicht übel. Ein Neubau, ruhig gelegen, mit Blick auf ein Weizenfeld. Na gut, ein bisschen schmal geschnitten vielleicht: 80 Zentimeter tief und eng wie ein Jackenärmel. Den zukünftigen Bewohner der Röhre kümmert das allerdings nicht. Es ist Juni, bis zum Herbst kann er locker ein paar Extra-Kammern anbauen.
Seine Umzugshelfer würde das freuen. Sie sind Tierschützer und legen sich ordentlich ins Zeug, damit der Feldhamster einzieht – und sich endlich wieder wohlfühlt. In der ostfranzösischen Region Elsass buddeln sie für ihn Wohnröhren in den Boden. Denn der Kleine Kerle, große Sorgen: Jahrzehntelang futterten Feldhamster die Äcker der Bauern kahl. Dann wurden sie als Schädlinge bekämpft und fast ausgerottet.
In Frankreich versuchen Tierschützer nun, die Nager wieder anzusiedeln. Und buddeln sogar "Wohnungen" für sie kleine Nager macht ihnen große Sorgen. Ohne Hilfe wäre er in Deutschland, in den Niederlanden und Frankreich wohl längst ausgestorben.
Gehasst von den Getreidebauern
Dabei ist Cricetus cricetus, wie der Feldhamster wissenschaftlich heißt, an sich ein zähes Kerlchen. Mehr als doppelt so groß wie der berühmte Goldhamster, galt er in Westeuropa einst als Schrecken aller Getreidebauern. Zu Gesicht bekamen sie den knopfäugigen Vielfraß zwar selten - Feldhamster verkriechen sich 90 Prozent ihres Lebens im Bau.
Umso erstaunlicher, was sie in der restlichen Zeit alles anstellen: Vor allem nachts futtern sie sich die schwarzen Bäuche Einzelgängervoll. In ihren Backentaschen, die bis zu den Schultern reichen, bunkern sie den Rest der Beute: Rüben, Möhren, Kartoffeln, Klee, Getreidekörner. Bis in die 1980er Jahre hinein waren so große Hamster-Horden unterwegs, dass auf Feldern und Äckern oft riesige kahle Stellen entstanden. Und die Bauern hatten eine ordentliche Wut im Bauch!
Es gab sogar bezahlte Hamsterjäger, die den Tieren nachstellten. Sie legten Fallen aus oder ertränkten die Hamster in ihren Röhren. Millionen Felle wurden anschließend zu Decken und Mänteln verarbeitet.
Maisfelder sind kein gutes Zuhause
Und heute? Schaden vor allem die Bauern den Hamstern, nicht umgekehrt. "Der Mais hat in den vergangenen Jahren alles kaputt gemacht", sagt Jean-Paul Burget von der Naturschutzorganisation "Sauvegarde Faune Sauvage" (SFS). Immer mehr Bauern pflanzen die gelben Kolben auf ihren Feldern an, im Elsass sind 80 Prozent aller Ackerflächen voll damit. Mais bringt nämlich mehr Geld als etwa Weizen oder Hafer.
Nur: Für Hamster sind Maisfelder ein Graus. Wenn die Tiere nach dem Winterschlaf aus ihrem Bau krabbeln, ist der Boden noch ratzekahl. Gesät wird frühestens im April. "Ohne Deckung werden die Hamster innerhalb von Minuten gefressen", sagt Burget. Raubvögel erbeuten sie, noch bevor die Nager im Frühling Nachwuchs bekommen. So kann der Bestand einer ganzen Region in wenigen Jahren verschwinden. Im Elsass zählte man zur Jahrtausendwende rund 1150 Tiere in freier Wildbahn, heute sind es nur noch 500.
Weil Politiker nichts gegen das Hamstersterben unternahmen, klagte Jean-Paul Burget vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Frankreich drohten danach Geldstrafen in Millionenhöhe, sollte das Land sich nicht endlich um die Hamster kümmern. Nun steckt die Regierung jedes Jahr 500 000 Euro in ein Schutzprojekt – macht aktuell 1000 Euro pro Feldhamster. Der Schädling von einst ist wertvoll geworden!
Partnervermittlung für Feldhamster
Drei Zuchtstationen gibt es inzwischen im Elsass. Die Tierschützer von SFS brauchen mindestens 1500 frei lebende Feldhamster, um die Art zu erhalten. Deshalb helfen sie bei der Partnervermittlung. Jedes Tier hat seinen eigenen Käfig. Die Männchen hausen in den Zuchtgehegen immer über den Weibchen. So können die wählerischen Damen ihre zukünftigen Partner erschnuppern.
Doch selbst wenn sich ein Hamsterpärchen riechen kann – eine Paarungsgarantie ist das nicht. Oft sind die Weibchen aggressiv. Stellen sie sich knurrend und zischend auf die Hinterbeine, bedeutet das: Ärger! Die Männchen sollten sich dann lieber ducken.
Natürlich haben die Tierschützer die Raufbolde genau im Blick... Verläuft alles friedlich, gibt es nach drei Wochen Baby-Hamster, fünf sind es im Schnitt. Nackt, taub und blind kuscheln sich die Kleinen ins Heu. Sie bleiben in der Station und werden einmal die nächste Hamster-Generation zur Welt bringen. Ihre Eltern fressen sich unterdessen noch ein letztes Mal im Käfig kugelrund. Dann heißt es für sie: ab in die Freiheit.
Keine Angst vor Feinden
In kleinen Transportboxen aus Holz tragen Helfer rund 300 Hamster aufs Feld. Ringsum steht der Weizen hüfthoch, ein Paradies für die Nager! Der Bauer, der dieses Getreide statt Mais anbaut, bekommt Extrageld von der Regierung. Für jeden Hamster haben die Tierschützer eine Röhre im Boden vorbereitet. Männchen und Weibchen ziehen stets in benachbarte Baue. Sie sollen schnell zueinanderfinden, um sich ein zweites Mal zu vermehren.
Die Tierschützer halten die Holzboxen direkt über die Löcher. Klappe auf. Schon huscht der Nager in die Erde und beginnt zu buddeln. Dieses Verhalten ist zum Glück angeboren. Mit anderen Reaktionen hapert es dafür gewaltig: Die Zuchthamster kennen keine natürlichen Feinde wie Füchse, Marder oder Katzen. Warum also verstecken? "Jedes Feld ist von einem Elektrozaun umgeben, damit die Hamster sicherer sind", sagt Jean-Paul Burget. "Genauso, wie man es von Kuhweiden kennt." Doch selbst wenn weniger Feinde lauern: Unbeobachtet sind die Hamster in Freiheit niemals.
Feldhamster mit Personalausweis
Mit aufwendiger Technik verfolgen Forscher der staatlichen französischen Wildtierbehörde ONCFS die Nager auf Schritt und Tritt. Jedes Tier ist mit einem Chip und einer Nummer ausgestattet – gewissermaßen ein Hamster-Personalausweis. Und noch etwas: Jedes Weibchen trägt einen Mini-Sender bei sich, der auf Körperwärme reagiert.
Ein Tierarzt hat die winzigen Geräte in die Bauchhöhle eingesetzt. Solange das Weibchen lebt, funkt der Sender: Hamster wohlauf! Wird es erbeutet, verstummt das Signal. Nur 60 Prozent der ausgewilderten Hamster überleben das erste Jahr in Freiheit. Der Sender verrät den Forschern auch, wo ein Hamster gerade steckt. Mit einem Empfangsgerät und einer Antenne in der Hand schreiten sie zweimal pro Woche das Feld ab.
Je näher sie einem Tier kommen, desto heftiger piept es aus dem Empfänger. Funkt ein Weibchen drei Wochen lang immer vom selben Ort, heißt das: Es bleibt im Bau! Junge sind geboren! Mit viel Glück haben die Forscher an der richtigen Stelle eine Fotofalle aufgestellt, und die Hamster liefern einen Schnappschuss. Selbst misstrauische Bauern müssen lächeln, wenn sie so ein Familienfoto sehen. Und wer weiß: Vielleicht lassen sie die nächsten Hamster ja auf ihrem Feld einziehen.