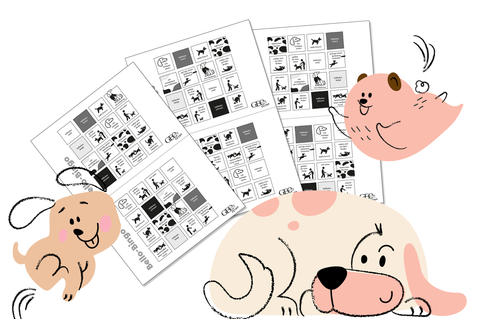Ich war neun, als ich erblindete. Meine Mutter war seit vier Jahren tot, mein Vater starker Alkoholiker. Ich glaube, am Anfang nahm mein Vater gar nicht richtig war, dass ich blind war. Vielleicht verstand er nicht, was das überhaupt bedeutete. Ich verstand es ja selber nicht wirklich. Alles war plötzlich dunkel, als ob immer Nacht herrschen würde. Doch nie waren Sterne oder der Mond am wolkenlosen Himmel zu sehen.
Papa verstand das alles nicht, das merkte ich sofort und komischerweise tat es mir gar nicht richtig weh, jedenfalls zeigte ich das nicht und versuchte es auch zu verdrängen, dass er mich immer noch grob behandelte. Er hatte kein Wort gesagt, als der Arzt uns mitgeteilt hatte, dass ich nie wieder würde sehen können. Er sagte, dass ich in wenigen Tagen blind sein würde, man könnte mir nicht mehr helfen. Die Krankheit war nicht heilbar, es täte ihm sehr leid. Papa hatte sich bedankt und zu Hause hatte ich sofort das Geschirr spülen müssen. Meine kleine Schwester Alma war noch zu klein gewesen - sie war gerade mal fünf - und verstand die Welt nicht mehr. Sie verstand nicht, warum ich so lange brauchte, um ein Zimmer zu durchqueren, verstand nicht, warum ich mich an allem festhalten musste, verstand nicht, warum ich so traurig war und oft abends im Bett, wenn Papa es nicht sehen konnte, weinte.
Am Anfang war es - natürlich - schwer für mich. Leben in ewiger Dunkelheit, das konnte ich mir nicht vorstellen. Oft versuchte ich mir einzureden, dass es nur ein Scherz von Gott sei, dass er mir nur für einige Tage ein schwarzes Tuch um die Augen gebunden hatte um mir zu zeigen, wie es war, blind zu sein. Doch Wochen vergingen und Gott nahm das Tuch nicht weg, er zeigte kein Erbarmen. In dieser Zeit verlor ich übrigens mein Vertrauen in Gott. Ich war sauer auf ihn und traurig, dass er das zuließ. Seitdem war er alles andere als eine Person, die einem half. Ich wusste, dass ich blind war und nichts daran ändern konnte. Doch ich wollte es nicht wahrhaben. Einerseits wollte ich von allen normal behandelt werden, andererseits wollte ich, dass mein Vater Mitleid mit mir hatte. Doch er erfüllte genau meinen ersten Wunsch. Er behandelte mich so wie vorher. Und deswegen hasste ich ihn. Ich musste alles machen, den ganzen Haushalt, musste einkaufen gehen, Wäsche waschen, auf Alma aufpassen. All das, was ich nicht konnte. Und er gab mir keinen Ausgleich. Er schickte mich nicht auf eine Blindenschule, gab mir keine Chance. Dabei wollte ich doch so gerne wieder lernen, wieder unter Leute. Wollte meine alten Freunde wiedersehen, die sich nie wieder bei mir gemeldet hatten. Ich wollte einfach ein Leben führen, das für ein blindes Mädchen angemessen war. Doch mein Vater wollte offenbar nicht, dass es mir gut ging, also ging es mir auch nicht gut.
Die Monate vergingen und ich fand mich mit der Tatsache ab, dass ich nie wieder würde sehen können. Ich versuchte mir selbst beizubringen, wie ich die Welt hören und riechen und fühlen konnte. Ich entdeckte die Welt neu, erkannte Sachen, die mir vorher nie aufgefallen waren. Irgendwie hatte es also auch etwas Gutes gehabt. Doch das merkte ich lange nicht. Ich versuchte, mich mit meiner neuen Welt zurecht zu finden und versuchte, sie zu lieben. Ich schaffte das auch, aber nur ein bisschen und auf meine eigene Art. Das wirklich Wahre war es leider nicht. Aber ich musste mich damit abfinden, ändern konnte ich eh nichts mehr dran, also tat ich das auch. Die Wendung in meinem Leben begann wahrscheinlich mit Olga. Olga war eine Frau vom Jugendamt und als sie das erste Mal zu uns kam, war ich 10 und stand in der Küche am Herd. Als es an der Tür klingelte, öffnete mein Vater widerwillig, eine Bierflasche in der Hand. Als Olga die Wohnung betrat, verbrannte ich mir gerade einen Finger, weil ich aus Versehen die heiße Herdplatte berührte und schrie kurz auf. "Was war das?", fragte sie. "Meine Tochter Natasha. Das Mädchen ist zu dumm, um Essen zu machen", nuschelte Papa. Olga lugte in die Küche und sah mich da stehen, am Daumen lutschend und verloren mitten in dem kalten Raum. Ich bemerkte sie nicht und streckte nach einem Moment den Arm aus, um mich zum Kühlschrank vor zu tasten. Ich stieß mir den Kopf am offenen Fenster. Wahrscheinlich war das der Moment, in dem Olga beschloss, dass ich hier nicht bleiben konnte. Sie sah sich die Wohnung genauer an und machte sich ein Bild von unserer Familie. Mein Vater dachte sich nichts dabei. Er meinte wohl, Olga wäre nur irgendeine Frau. Zwei Monate später bekam er einen Brief vom Jugendamt, in dem ihm sein Sorgerecht entzogen wurde. Eine Woche später stand Olga vor der Tür, um Alma und mich abzuholen. Ich weiß noch genau, dass ich einfach mitging, ohne mir richtige Gedanken drüber zu machen, wer sie war und warum sie uns abholte. Ich wollte einfach raus, wollte endlich wieder glücklich sein. Und ich wurde einfach das Gefühl nicht los, dass dieser Wunsch mit Olgas Hilfe in Erfüllung gehen könnte...
Sie brachte Alma zu einer Pflegefamilie, die in einem Reihenhaus wohnte und sie winkend am Gartentor empfing. Olga erzählte mir das, als Alma schon ausgestiegen war. Mich nahm sie weiter mit. Ich hatte es immer noch nicht fassen können, dass sie uns getrennt hatte. Eigentlich hatte ich gedacht, dass wir zusammen glücklich werden würden. Und deshalb war ich enttäuscht von Olga. Ganz plötzlich, so schnell wie ich vorher von ihr begeistert war.
Wir fuhren lange. Zweieinhalb Stunden waren es und während dieser Zeit redeten wir kein Wort. Das war wahrscheinlich auch ihr Glück, denn ich hätte sie bestimmt angeschrien.
Als das Auto langsamer fuhr und irgendwann ganz zum Stehen kam, war ich eingeschlafen. Olga weckte mich, half mir raus und flüsterte mir dann ins Ohr: "Auch wenn du es jetzt nicht sehen kannst, Natasha, aber du stehst gerade vor einem riesigen alten Gebäude, dass inmitten von einem Wald steht. Ein kleiner Bach fließt rechts neben dir und aus der großen, alten Eichentür kommt gerade eine Frau hinaus, die uns zulächelt. Willst du wissen, was du hier machst?" Ich nickte leicht verunsichert. "Das ist ein Internat für blinde Kinder, Natasha. Du wirst ab sofort hier wohnen und zur Schule gehen. Freust du dich?" Ich glaube, ich hatte noch nie etwas so Schönes gehört. Und ich war so glücklich. Ich freute mich wahrscheinlich mehr, als es sich Olga überhaupt vorstellen konnte.
Ich bin Olga so dankbar, dass sie mich hierher gebracht hat. Zwei Jahre sind seitdem vergangen. Am Anfang war es schwierig für mich in einem neuen Zuhause leben zu müssen. In der alten Wohnung hatte ich mich wortwörtlich blind ausgekannt, hier musste ich das erst lernen. Ich kam in ein Zimmer mit Simona, einem damals 9 Jahre alten, selbstverständlich blinden Mädchen, das hier schon seit zwei Jahren lebte. Ich freundete mich sofort mit ihr an, es war sozusagen Freundschaft auf die erste Berührung. Und es machte mir soviel Spaß mit ihr zusammen zu sein. So wie es mir auch mit fast allen anderen Kindern und Jugendlichen hier gefiel. Es war wie im Paradies, nur unter Gleichgesinnten, denen das ähnliche Schicksal bevorstand, wie mir. Manche waren seit ihrer Geburt hier, weil ihre Eltern sie nicht gewollt hatten; andere waren erst später gekommen, manche waren schon blind auf die Welt gekommen, andere waren erst nach einiger Zeit erblindet. Ich fühlte mich wohl, von Anfang an. Ein paar Wochen lang schrieb ich Alma regelmäßig Briefe, zweimal bekam ich eine Antwort, dann gab ich es auf. Zuerst brach es mir das Herz, doch dann fand ich mich damit ab und dachte nur noch wenig an sie. An Vater dachte ich gar nicht mehr. Er war eigentlich gar nicht da und ich machte mir vor, dass er auch nie dagewesen war.
Das Internat machte aus mir wieder einen Menschen, der froh war, auf der Welt zu sein. Hier lernte ich, mein Leben zu lieben so wie es war. Dabei half mir vor allem Simona. Sie nahm mich mit in den Wald, um mich die Natur hören zu lassen, zeigte mir, wie man die innere Schönheit der Menschen erkennen konnte und ließ mich fühlen, was ich früher noch nicht mal gesehen hatte.
Jetzt sitze ich hier auf der breiten Fensterbank meines Zimmers und höre hinaus. Der Frühling hat gerade begonnen. Es riecht so schön nach Maiglöckchen und Veilchen, nach Tau und Wald. Es riecht nach Sonne und Wärme. Es ist mein zweiter Frühling hier im Internat. Ich bin jetzt 12 Jahre alt und glücklich. Verträumt befühle ich die Blume, die ich heute morgen in aller Frühe - noch vor dem Frühstück - am Waldrand gepflückt habe. Es ist Mittagspause, in einer Stunde muss ich wieder in den Unterricht. Doch bis dahin kann ich noch den Einzug des Frühlings genießen.
Ich höre nur die Tür aufgehen und dann aufgeregtes Getrampel. Kurz darauf einen hohlen Klang und Simona heult auf.
"Ich vergesse immer wieder, dass dein Bett soweit ins Zimmer hinaus ragt. Wir sollten es unbedingt umstellen, am besten ganz weit weg, Natasha. Irgendwann breche ich mir noch was."
Ich muss grinsen und wende mich in die Richtung, aus der ich die Stimme meiner Freundin erwarte. Sie atmet schwer und stoßweise, anscheinend hat sie sich beeilt hierher zu kommen.
"Weißt du was?", fragt sie, ganz nah an meinem Gesicht. Ich kann ihren Atem spüren. Sie klingt aufgeregt.
"Es gibt einen Neuen. Ray heißt er, Ray Charles Robinson."
Jetzt bin auch ich aufgeregt. Neue sind immer etwas Besonderes und fast alle Schüler versammeln sich dann, um das Greenhorn kennenzulernen.
"Komm schnell, bevor alle anderen da sind. Sonst ist er schon so abgegriffen", schlägt Simona vor und ich willige sofort ein. Hand in Hand verlassen wir so schnell wie möglich das Zimmer, wobei Simona ein weiteres Mal gegen mein Bett läuft. Lachend tasten wir uns den Flur entlang, immer an der Wand entlang, die uns sozusagen führt. Wir laufen die alten, knarrenden Treppen hinunter, die sehr uneben sind und man muss sie sehr gut kennen, um nicht an den dünneren Stufen auszurutschen. Nachdem wir auch noch die kleine Eingangshalle so schnell wie möglich durchquert haben, erreichen wir den Kiesvorplatz. Es riecht noch ganz leicht nach Autoabgasen und wir hören die Leiterin des Internates, Frau Kelly, mit einem Mann sprechen. Langsam nähern wir uns den Stimmen und bleiben dann ganz nah bei der Leiterin stehen.
"Oh, hallo ihr beiden! Ihr kommt bestimmt, um Ray zu begrüßen!"
Wir nicken beide gleichzeitig und sie nimmt unsere Hände und legt sie in die eines Jungen. Etwas verschwitzt sind seine und sehr klein. Er ist anscheinend noch nicht alt, jedenfalls nicht so alt wie wir.
"Bist du schwarz?", fragt Simona gerade heraus und hebt den Kopf.
"Ja", antwortet der Junge und fragt dann: "Woher weißt du das?"
"Ich fühle es", antwortet sie " Deine Haut fühlt sich einfach dunkel an" Sie dreht sich um und sagt in meine Richtung gewandt: "Ich gehe wieder nach oben. Kommst du mit Natasha?"
"Ja", flüstere ich, bewege mich aber keinen Zentimeter.
"Darf ich dein Gesicht berühren?", frage ich Ray schüchtern.
Ich glaube, er ist erstaunt. Jedenfalls brummelt er kurz und sagt dann ja. Vorsichtig, so wie Simona es mir beigebracht hat, hebe ich meine Hand und nähere mich ganz langsam der Stelle, an der ich sein Gesicht vermute. Einen Moment später liegen meine Hände auf seinen Haaren. Kurz sind sie, fast kahl geschoren und ich glaube, sie sind schwarz. Jedenfalls fühlen sie sich fest und drahtig an. Schwarze Haare sind meistens fest und drahtig. Das habe ich im Laufe der Jahre gelernt. Seine Gesichtszüge sind weich und gehen fließend ineinander über. Er hat Pausbacken und geschmeidige Haut. Wie die Haut eines Babys. Auf der Nase liegt eine Brille, groß ist sie und rechteckig. Diese Tatsache irritiert mich zuerst. Blinde brauchen keine Brille. Es herrscht doch sowieso immer Nacht. Seine Nase ist genau richtig. Nicht zu groß und nicht zu klein. Er lacht, als ich sie berühre. Wahrscheinlich ist er kitzelig. Das bringt auch mich zum Lachen. Wir stehen da, meine Hände auf seinem Gesicht... und lachen. Sein Lachen klingt ernsthaft und doch frei. So frei wie das Krächzen von einem Albatross über dem Meer. Oder wie der Wind, wenn er über das Land streift und die Blätter zum Rascheln bringt. Rays Lachen fasziniert mich sofort und doch finde ich es komisch, dass er so frei lachen kann, wenn er doch gerade einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Ein weiteres Mal fahre ich mit meinen Fingern über sein ganzes Gesicht und lasse meine Hände dann sinken.
Leise flüstere ich:
"Tschüss. Bis später."
Dann renne ich weg. Nein, ich stolpere weg, und das viel zu schnell. Eigentlich ist es schon von vornherein klar, dass ich hinfallen werde. Ich vergesse, dass Simona da noch irgendwo steht und renne sie um. Wir landen auf dem Boden, ich rapple mich aber schnell wieder auf, ohne etwas zu sagen. Zusammen gehen wir die Treppen hoch. Als wir vor unserem Zimmer stehen, fragt Simona:
"Er ist nett, oder?"
Ich nicke obwohl ich weiß, dass sie meine zustimmende Bewegung gar nicht sehen kann.
Um halb 6 abends habe ich Klavierunterricht. Der große Saal mit dem Flügel drinnen ist ganz oben unter dem Dach. Ich liebe diesen Raum, weil dort immer Musik ist, egal ob jemand ein Instrument spielt oder nicht. Immer klingen irgendwelche Töne und schweben noch herum. Es riecht nach Holz und Freude, nach Energie und Kreativität. Ich gehe gerne zum Klavierunterricht. Leslie, die Lehrerin, ist nett und noch sehr jung. Mit ihr macht es Spaß, zu lernen.
Als ich diesmal den Raum betrete, ist nicht nur Leslie da. Das spüre ich. Normalerweise hat vor mir niemand Unterricht. Doch diesmal klimpert jemand auf den Tasten herum. Dieser jemand spielt ein Volkslied, etwas altes und ziemlich langweiliges, wie ich finde. Doch er spielt das irgendwie schön. Wenn ich Lieder dieser Art spiele, dann mit wenig Spaß und nicht viel Energie, ich reihe einfach ein paar Töne aneinander. Bei dem anderen klingt es ganz anders. Irgendwie klingt es noch nicht mal nach einem Volkslied. Es wird mit Freude und Spaß gespielt, mit viel Kraft und man merkt, dass diesem Jemand jeder Ton, jede Taste, wichtig ist und er sie liebt.
"Ach, Natasha! Schön das du da bist. Darf ich dir Ray vorstellen? Er ist neu und heute ist seine erste Stunde. Findest du nicht, dass er sich prächtig schlägt?"
"Wir kennen uns schon. Hallo Ray!", sage ich und trete auf den Flügel zu. "Ja, ich finde auch, dass sich das ziemlich toll anhört."
Leslie lacht und Ray klimpert verspielt weiter. Ich stehe da und höre ihm zu. Er spielt wirklich gut. Dafür, dass es seine erste Stunde ist, ist es wirklich toll.
Nach zwei weiteren einfachen Stücken beendet Leslie die Stunde und verabschiedet sich von Ray.
"Wollen wir uns später noch treffen?", rufe ich ihm hinterher und er antwortet mit einem viel zu raschen "Ja."
Und schon kann es los gehen. Voller Freude und mit viel Spaß haue ich in die Tasten und versetzte selbst Leslie in Staunen. Meine Finger schweben nur so, die Töne sammeln sich im Raum und ich stelle mir vor, dass der Saal ein Ballsaal ist und viele Leute da sind und alle zu meiner Musik tanzen. Es ist eine schöne Vorstellung in der schwarzen, sternenlosen Nacht.
Nach dem Abendessen versammeln sich fast alle Jugendlichen und Kinder aus dem Internat im großen Saal. Das machen wir jeden Abend, es ist eine Art Ritual. Und es ist immer eine tolle Stimmung. Alle bringen ihre Musikinstrumente mit und wir spielen uns gegenseitig vor. Dann sitzen wir auf Kissen auf dem kalten Boden, hören einander zu und trinken Traubensaft. Wir spielen Klassik und selbst erfundene Stücke, Volkslieder und Jazz. Henry spielt immer auf seinem Saxophon und jeden Abend das gleiche Lied. Marie und Elisabeth spielen Duette auf der Geige. Klara zupft etwas auf ihrem Kontrabass und einige spielen Klarinette. Aber die meisten spielen auf dem Klavier. Alle hier haben mit dem Klavier angefangen, alle könnten etwas spielen, doch nicht viele wollen es noch. Die meisten finden, dass Klavierspielen langweilig ist. Deswegen spielen immer Richy, Toni, George, Odette, Rosa und ich. Es macht wirklich Spaß und der Applaus am Ende ist das Beste. Jetzt sitzen wir wieder alle zusammen, erzählen uns von dem Tag und hören dem Spielenden zu. Um halb Neun haben alle einmal gespielt und viele wollen nach unten gehen. Doch da kommt noch einmal Bewegung in die Gruppe und jemand steht auf, er geht langsam auf das Piano zu, es dauert lange, bis er dort angekommen ist und fängt an eine einfache Melodie zu spielen. Ich kenne dieses Lied. Ray hat es heute beim Klavierunterricht gespielt. Deswegen frage ich laut in den Raum hinein:
"Ray? Bist du das?"
Und er antwortet:
"Ja. Soll ich weiter machen?." Alle sind begeistert und stimmen ihm zu. Er spielt einfach drauf los. Alle hören erstaunt zu, denn diese Art von Klavierspielen kennen wir nicht. Es hört sich irgendwie anders an, so langsam und doch mit so viel Energie. Dunkel, ist es, wie ich finde, und schwer. Doch manchmal spielt Ray ein paar hohe Töne und es ist, als würde die Sonne aufgehen. Ich sitze da und fange an zu träumen. Die Musik erinnert mich an ein kleines, enges Tal zwischen zwei großen Bergen. Dichter Nebel liegt über dem Fluss, der sich durch das Tal schlängelt und alles ist dunkel. Die Klänge sind schwer, blau, so stelle ich sie mir jedenfalls vor. Plötzlich erscheint die Sonne, einzelne Strahlen durchbrechen die Nebeldecke und das Wasser des Flusses fängt an zu glitzern. Ray spielt eine flotte Melodie, seine Finger gleiten über die Tasten und lassen etwas erklingen, das anders ist. Anders als alles, was wir hier lernen. Es ist Freiheit und Glück, Geborgenheit und Trauer. Mit einem lauten, lang anhaltenden Akkord beendet Ray sein Stück. Die Töne liegen noch lange in der Luft, es kommt mir so vor, als ob sie nie wieder aufhören wollen, zu klingen. Eine schöne Stille liegt über uns, niemand sagt etwas und auch Ray, dort vorne, ist still. Alle haben das Besondere bemerkt und niemand will die Magie dieses Augenblickes zerstören.
Und dann fragt jemand:
"Du bist neu, oder?"
"Ja", antwortet er.
"Hast du vorher schon Klavier gespielt?", fragt George, der beste Klavierspieler auf dem Internat.
"Nein. Unser Nachbar hat mir manchmal ein paar Griffe gezeigt, aber richtig gelernt habe ich es noch nie."
"Dafür spielst du aber schon richtig gut", sagt Simona.
"Danke. Ich liebe es auch. Es ist wunderschön, Musik zu machen."
"Was war das für eine Musik? Ich habe sie noch nie gehört", sagt George, der sich wirklich dafür zu interessieren scheint.
"Man nennt es Blues. Es ist die Musik der Schwarzen", erklärt Ray leise.
"Es war wunderschön", stellt George fest. Fast alle stimmen ihm murmelnd zu.
"Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf?", sagt Klara.
"Aus Albany", antwortet er.
"Und wie alt bist du?", fragt Toni.
"Sieben", antwortet Ray etwas kleinlaut. Ich glaube er denkt, er wäre zu jung für diese Runde. Wenn er wüsste, wie viele Siebenjährige in diesem Raum sind, wäre er wahrscheinlich nicht so schüchtern.
"Und bei wem, sagtest du, hast du immer Klavier gespielt?", fragt Klara noch einmal.
"Bei unserem Nachbarn. Er besaß die einzige Kneipe im Ort, in der es ein Piano gab. Dort bin ich immer hingegangen, seit ich laufen konnte, und habe versucht, Töne aus dem Klavier heraus zu bekommen." Alle lachen und hören ihm dann weiter gebannt zu. Jetzt ist er gar nicht mehr zu bremsen und erzählt alles, was ihm gerade einfällt:
"Mein Vater war schon lange tot, ich lebte nur mit meiner Mutter und meinem Bruder in einer kleinen Wohnung. Mein Bruder ist gestorben, als ich 5 Jahre alt war. Ich konnte ihm nicht helfen, weil ich noch zu klein und zu schwach war." Ich kann förmlich hören, wie er sich Tränen aus den Augen wischt. In diesem Moment tut er mir so leid und ich traue mich kaum zu atmen, weil ich Angst habe, die Stille zu stören, die sich über den Saal gelegt hat. In diesem Moment bin ich ehrlich gesagt richtig froh, dass ich ihn nicht sehen kann. Er muss traurig sein. Doch nach einigen Sekunden räuspert Ray sich vorne am Klavier und sagt dann beschwichtigend:
"Aber das ist längst vergangen." Und seine Stimme hört sich gar nicht mehr so traurig an.
Odette ringt sich durch, doch etwas zu fragen:
"Wie lange bist du schon blind?"
"Hm... richtig blind bin ich erst seit ein paar Monaten. Vorher konnte ich nur sehr schlecht sehen, meine Augen haben immerzu getränt. Irgendwann bin ich dann völlig blind geworden."
Er schweigt und wir schweigen auch. Es ist eine schöne Stimmung gerade, Ehrlichkeit liegt in der Luft. Nach einigen Minuten Schweigen steht George auf und murmelt etwas von "spät" und "schlafen". Nun kommt Bewegung in den Raum. Viele folgen seinem Beispiel und suchen sich einen Weg raus, rufen sich Grüße zu und verschwinden dann. Am Ende sind nur noch Simona, Odette, Toni, Ray und ich da.
"Kommst du auch mit runter, Ray?", fragt Toni. Ray steht geräuschvoll auf und kommt langsam auf uns zu.
"Wie komme ich raus?", fragt er schüchtern. Von dem Selbstbewusstsein von vorhin ist nichts mehr zu erkennen.
"Komm. Wir zeigen es dir." Simona nimmt ihn an die eine Hand, ich nehme seine andere und wir führen ihn hinaus. Wir helfen ihm auch noch die schmalen, ausgetretenen Treppen hinunter, auf denen man so schlecht laufen kann. Sie knarren alle und viele sind schon so abgetreten, dass sie nur noch einige Zentimeter breit sind und man kann leicht ausrutschen. Außerdem ist das Geländer nicht sehr stabil und als Blinder kommt man hier alleine fast nicht runter. Ich fühle mich wieder in die Vergangenheit zurück versetzt. Ich habe Alma auch immer an der Hand genommen und habe ihr geholfen, als sie noch nicht richtig laufen konnte. Es war ein tolles Gefühl, jemandem zu helfen, ihn zu beschützen und zu zeigen, dass man für ihn da war. Jetzt fühle ich mich genauso. Und das tut gut. Niemand sagt ein Wort, die anderen beiden laufen hinter uns. Auf dem Flur trennen wir uns. Toni und Ray gehen durch die schwere Eichenholztür in den Bereich der Jungs. Odette verabschiedet sich von uns mit einer Umarmung und tastet sich dann so schnell wie möglich an den Wänden entlang zu ihrem Zimmer. Simona und ich gehen in unser Zimmer und nachdem meine Freundin ein weiteres Mal an mein Bett gestoßen ist und ein weiteres Mal beschlossen hat, dass sie es bald umstellen wird, machen wir uns fürs Bett fertig. Einige Minuten später liegen wir in unseren Betten, eingemummelt in die viel zu warmen, kratzigen Decken, die so schrecklich riechen und doch so gemütlich sind.
Es ist Nacht, aber eigentlich kann ich es nur erahnen. Ich kann nicht sehen, ob der Mond am Himmel steht, ob die Sterne hell leuchten oder ob sie von Wolken verdeckt sind. Es herrscht Nacht, und das immer. Auch am Tag, der für mich kein Tag ist. Und obwohl ich die Augen offen habe, ist alles schwarz. Auch wenn ich mich in den letzten Jahren daran gewöhnt habe und es fast normal für mich geworden ist, holt mich die Realität in diesem Moment ein und ich hasse meine eigene dunkle Welt, in der es kein Licht gibt.
Fast 2 Wochen ist es jetzt her, seit Ray ins Internat gekommen ist. Er ist nett, ja, aber mehr kann ich von ihm noch nicht sagen. Bis auf den vergangenen Abend im großen Saal habe ich nichts weiter mit ihm zu tun gehabt. Das finde ich schade, denn irgendwie fasziniert er mich. Einen genauen Grund kann ich auch nicht nennen. Vielleicht ist es sein Lachen. Seit seiner Ankunft hat es mich nicht mehr losgelassen und ich höre es immer wieder. Auf dem Flur, im Essensaal, draußen auf dem Hof. Vielleicht ist es aber auch die Musik, die er uns gezeigt hat und die mich fasziniert. Und genau weil ich ihn so interessant finde, will ich ihn näher kennen lernen. Doch eine Gelegenheit bot sich bisher nie. Leider.
Jetzt sitze ich draußen, im Hof, auf einem großen Stein und halte mein Gesicht der Sonne entgegen. Die Strahlen berühren meine Haut und ich sitze einfach nur da und denke an gar nichts. Gestern Nacht hat es geregnet, es riecht nach nassem Gras und Frühling. Ich rieche den Duft der Blumen, höre Vögel singen und den Wind leise durch die Blätter des Waldes rauschen. Es ist schön hier. Ich liebe den Frühling. Er ist ? neben dem Herbst ? die lebhafteste Jahreszeit. Auch wenn ich nicht sehen kann, wie der Natur neues Leben eingehaucht wird, spüre ich es. Und das ist fast schöner als damals, als ich es noch sehen konnte. In solchen Moment mag ich es, blind zu sein.
Da höre ich auf einmal ganz in meiner Nähe Schritte auf dem Kies.
"Hallo?", frage ich vorsichtig. Die Person bleibt erstaunt stehen und sagt dann:
"Wer ist da?" Dieser Jemand sagt es nicht in meine Richtung und sehr leise, doch trotzdem glaube ich, Rays Stimme zu erkenne.
"Natasha. Bist du das, Ray?"
"Ja."
Langsam und vorsichtig stehe ich auf und gehe mit tastend ausgestreckten Armen in die Richtung, in der ich seine Stimme vermute. Als ich seine Nähe spüre, berühre ich auch schon vorsichtig sein Gesicht.
"Hi!", sage ich. Er antwortet nicht, sondern steht einfach nur da.
"Was machst du hier draußen?", fragt er nach einer Weile.
"Ich schaue dem Frühling beim Kommen zu", erkläre ich ihm und merke, dass er etwas verwirrt ist.
"Du tust was?", fragt er verwundert.
"Ich schaue dem Frühling beim Kommen zu." Da bemerke ich meine falsche Wortwahl und fange an zu lachen.
"Oh... entschuldige, ich hab da wohl was durcheinander gebracht."
Jetzt lachen wir beide und ich würde ihn irgendwie jetzt gerne sehen.
"Ich meine natürlich, dass ich dem Frühling beim Kommen zuhöre und fühle."
"Wie meinst du das?", fragt Ray.
"Soll ich es dir zeigen?" Ohne eine Antwort abzuwarten, greife ich nach seiner kleinen, kindlichen Hand und ziehe ihn hinter mir her. Ich weiß ungefähr, wo der Wald anfängt und taste mich vorsichtig an die Bäume heran.
"Du musst immer deine Hände ausstrecken, damit du nicht gegen einen Baumstamm rennst", erkläre ich ihm. Er sagt nichts, sondern umklammert meine Hand etwas fester. Vorsichtig betreten wir nebeneinander den Wald und suchen mit der noch freien Hand nach den Bäumen. Wenn wir einen erreicht haben, tasten wir uns zum nächsten vor. Es muss schwierig für ihn sein, denn wahrscheinlich ist er das erste Mal blind in einem Wald unterwegs. Ich war hier schon oft, fast würde ich sagen, dass ich mich auskenne. Für mich ist es eine Leichtigkeit, auf dem Moos sicher zu stehen und nicht gegen Bäume zu laufen.
Als wir einige Minuten gelaufen sind und unser Tempo gesteigert haben, riecht es plötzlich stärker als irgendwo anders nach nassem Gras, der Duft der Blumen ist intensiver und ich höre etwas entfernt das leise Plätschern des Bachs.
"Stop, Ray, wir sind angekommen. Soll ich dir jetzt zeigen, wie ich den Frühling fühle?", biete ich ihm an und er antwortet mit einem flüsternden "Ja". Ich glaube, er spürt, dass wir an einem besonderen Ort sind.
"Das hier ist eine Lichtung. Obwohl wir natürlich das Lichte, das Helle, nur fühlen können. Es ist meine Lieblingslichtung, weißt du. Hierher komme ich fast immer, wenn ich nachdenken will oder so etwas. Ich habe diesen Platz noch nie jemandem gezeigt. Du bist der Erste. Und ich möchte, dass du niemandem von hier erzählst."
"Klar. Das mache ich natürlich, Natasha", versichert er mir.
Ich ziehe ihn etwas weiter auf die Lichtung bis ich denke, dass wir in der Mitte sind.
"Leg dich hin Ray, aufs Gras." Wir legen uns nebeneinander.
"Stell dir vor, du kannst wieder sehen", beginne ich zu erzählen und schließe meine Augen, obwohl es sowieso nichts bringt. Es ist immer dunkel.
"Stell dir vor, du kannst in den Himmel sehen. Ein paar Wolken sind zu sehen, sie bilden eigenartige Formen. Vielleicht erkennst du ein Känguruh in ihnen oder einen Elefanten. Die Sonne scheint herunter, lässt das Wasser des Baches am Lichtungsrand glitzern und wärmt dein Gesicht. Jetzt, wenn ich gleich aufhöre zu sprechen, dann hör einfach nur auf die Natur. Versuch zu verstehen, was die Geräusche, die du hören kannst, zu bedeuten haben."
Und dann bin ich still und Ray auch. Fast kommt es mir vor, als würde er noch nicht mal atmen, jedenfalls nur ganz wenig. Und irgendwann denke ich gar nicht mehr an ihn, sonder lausche selber der Natur. Ich befühle mit den Händen das Gras. Pflücke eine Blume und rieche dran. Höre auf die vielen verschiedenen Vögel, die überall um mich herum zwitschern. Höre das Rauschen des Baches. Lasse mein Gesicht von der Sonne wärmen. Stelle mir die schönsten Bilder vor meinem inneren Auge vor; fantasiere, ich könnte sehen und würde die Sonne betrachten, würde die vielen verschiedenen Farben der Blumen bewundern, würde mein Spiegelbild im klaren Wasser des Baches anschauen. Ich stelle mir den Himmel vor, so unendlich blau und weit, ich sehe Tiere aus dem Wald kommen...
"Das ist unglaublich, Natasha, einfach unglaublich", flüstert Ray ganz hingerissen.
"Ich weiß Ray, ich weiß. Die Natur ist noch viel schöner, wenn man sie nur hören und fühlen kann."
"Ich wusste gar nicht, dass es auch einmal etwas Positives haben kann, blind zu sein."
"Das dachte ich auch nie. Aber seit ich heraus gefunden habe, was man alles fühlen kann, bin ich irgendwie manchmal froh, blind zu sein."
Und das meine ich ganz ehrlich. Wenn ich das sage, lüge ich mir oft selber was vor, aber diesmal stimmt es wirklich. In diesem Moment mag ich es, dass alles dunkel ist. Ich kann mir meine eigene Welt erstellen. Und das ist einmalig. Ich glaube, dass wird Ray auch gerade klar.
"Du hast Recht. Es ist toll", sagt er neben mir. Seine kleine Kinderhand greift wieder nach meiner.
Am Abend spielt Ray uns oben im Saal wieder auf dem Piano vor. Und wie er spielt! Seine Finger fliegen über die Tasten, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Er spielt einen Frühlingsblues, wie er es nennt, und ich hoffe, dass er ihn für mich und den wunderschönen Nachmittag spielt.