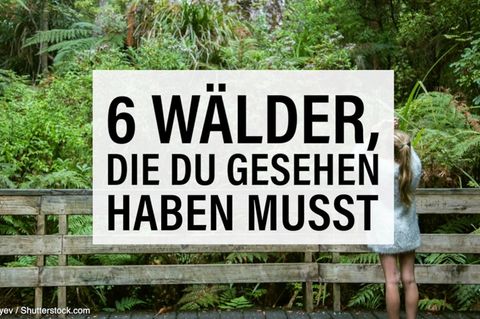Auf dem Ast der toten Buche drängt sich eine Armee von "Rothelmen". Gerade so, als wäre mitten im Wald ein Ufo gelandet und hätte sie ausgespuckt. Es sind aber keine Außerirdischen, die das modrige Holz in Beschlag genommen haben, sondern - Pilze. Lebewesen, die sich jedoch viel mehr unterirdisch, im Holz und im Boden, breitmachen. Denn das, was bei manchen Arten auf den Stämmen, bei anderen aus der Erde sprießt, ist nur ein kleiner Teil des ganzen Pilzes: Hut und Stiel bilden den Fruchtkörper. Den brauchen Pilze, um sich zu vermehren. Unter Tage oder in toten Bäumen aber spannt sich ein feines, weit verzweigtes Netz aus winzigen Fäden, Mycel genannt.

Ganze Wälder können die unterirdischen Geflechte eines einzigen Pilzes durchziehen. Der vermutlich größte wuchert im US-Bundesstaat Oregon auf neun Quadratkilometern, einer Fläche so groß wie 1360 Fußballfelder! Wissenschaftler schätzen, dass der Gigant - ein Dunkler Hallimasch - rund 600 Tonnen wiegt, so viel wie drei Blauwale. Damit ist weder eine Pflanze noch ein Tier das größte Lebewesen der Erde, sondern ein Pilz.

Dass der so riesig wurde, liegt sicher auch daran, dass Pilze ziemlich "gefräßig" sind. Zwar bewegen sie sich keinen Millimeter vom Fleck weg. Mit ihrem Mycel jedoch wachsen sie auf ihre "Beute" zu. Auf Laub etwa, abgefallene Äste - oder eben eine tote Buche. Die Fäden umwuchern den Stamm und zersetzen dessen Holz nach und nach. Sogar "fleischfressende" Pilze gibt es.
Weil Pilze - anders als Tiere - weder Mund noch Magen und Darm haben, sondern sie zur Verdauung Eiweiße ab, die die Beute in verwertbare Nährstoffe zerlegen. So können die Pilzfäden Laub, Holz und sogar Würmer einfach "aufschlürfen". Pilze arbeiten auf diese Weise als Müllabfuhr und Resteverwerter im Wald, egal ob sie Pflanzen oder Fleisch bevorzugen.
So lebensnotwendig das für die Pilze selbst ist - auch Pflanzen und Tiere haben etwas davon: Indem die Hutträger beispielsweise Blätter zersetzen, stellen sie Mineralstoffe wie Magnesium und Kalium für Bäume und anderes Grünzeug bereit. Ohne Pilze verschwänden diese Stoffe für lange Zeit unnutzbar im Waldboden. Das Leben, so wie wir es kennen, gäbe es nicht.
Darum "suchen" sich auch fast alle Pflanzen einen Pilz als Partner. Eine Lärche und ein Lärchenröhrling passen beispielsweise gut zusammen. Es ist ein Geben und Nehmen: Der Baum stellt seinem Pilz über die Wurzeln Energie in Form von Zucker bereit. Den können Pilze nämlich nicht selbst erzeugen. Im Gegenzug versorgt der Pilz den Baum mit Mineralstoffen und Wasser. Ohne dieses Tauschgeschäft im Untergrund könnten viele Bäume nicht richtig wachsen.

Nicht immer ist die Partnerschaft allerdings ausgeglichen. Manche Pilze schmarotzen sich als Parasiten durch den Erdboden. Sie zapfen die Wurzeln eines Baumes an und nutzen ihn als Zuckerlieferant, ohne eine Gegenleistung zu bringen. Auch der Dunkle Hallimasch aus Oregon hat schon manchem Baum Saft und Kraft aus dem Stamm gesaugt.
Zum Glück sind seine Verwandten in unseren Wäldern deutlich kleiner. Und gerade jetzt, im Spätsommer und Herbst, werden die Jäger unter Tage selbst zu Gejagten: Die hübschen Hutträger sind als Speisepilze beliebte Sammelobjekte.
Pilze sammeln - aber richtig!
Ab in die Pilze! Jetzt ist die beste Zeit zum Suchen und Finden. Die wichtigsten Tipps verrät euch Claudia Görke von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie - Pilzkunde
Worauf ihr unbedingt achten müsst:
Geht nur zusammen mit einem Erwachsenen, der sich auskennt, auf Pilzsuche!
Sammelt nur Pilze, die ihr auch wirklich als Speisepilze erkennt!
Fragt in Zweifelsfällen die Experten einer Pilzberatungsstelle!
Wer sich gar nicht auskennt, sollte erst einmal an Pilzführungen teilnehmen und keinesfalls allein suchen! Ansprechpartner findet ihr im Internet, etwa unter www.dgfm-ev.de.
Nehmt zum Sammeln immer einen Korb und ein kleines Messer mit.
Verarbeitet nur frische Pilze! Auch Champignons und Co. können schimmeln - und Schimmelpilze sind oft giftig.
Das dürft ihr auf keinen Fall:
Probiert niemals rohe Pilze! Viele Arten sind erst nach dem Kochen genießbar. Aber auch ungiftige, rohe Pilze können gefährlich sein, wenn Bakterien auf ihnen wachsen.
Transportiert Pilze nie in einer Plastiktüte! Sie schimmeln dann schnell.
Verlasst euch als Anfänger niemals allein auf Bücher zur Pilzbestimmung! Viele Arten kann man leicht verwechseln.
Sammelt keine Pilze in Naturschutzgebieten, das ist verboten.
Wenn ihr doch einmal einen euch unbekannten Pilz mitnehmen wollt: Packt ihn nicht zu den anderen! Wickelt ihn stattdessen in Alufolie. Und wie gesagt: Zeigt ihn anschließend einem Pilzexperten!