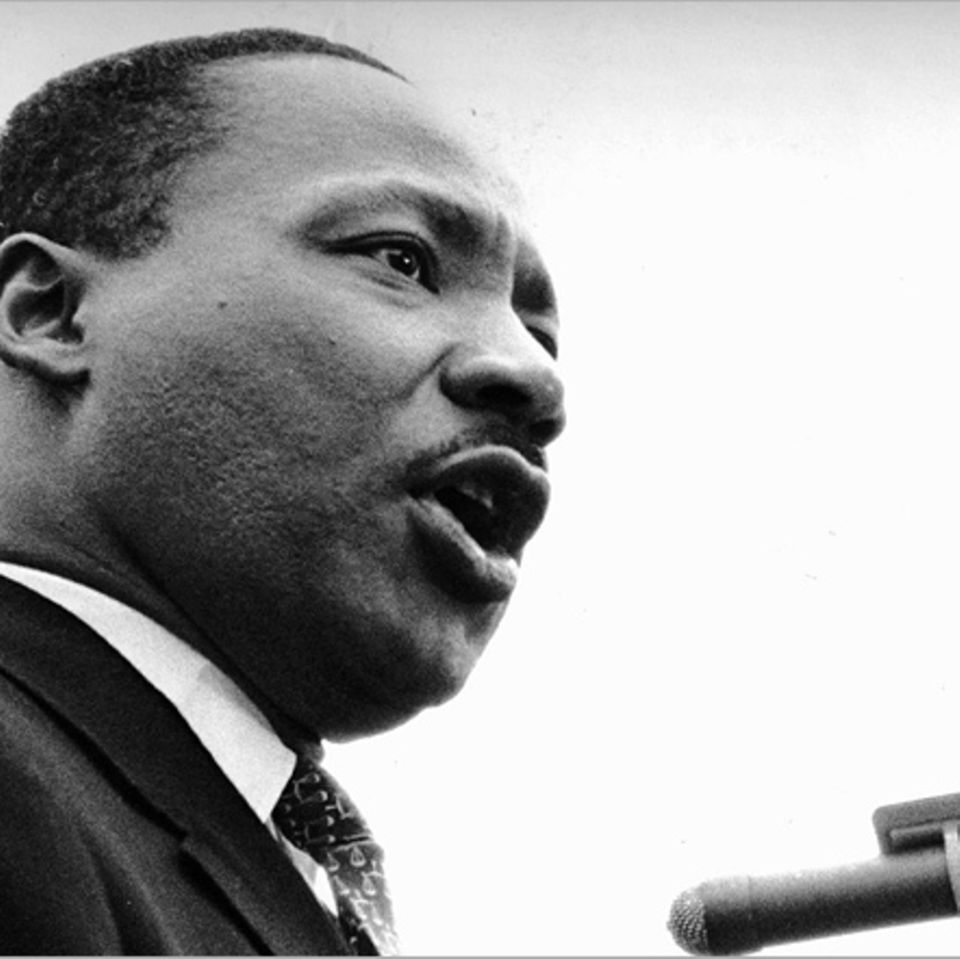Es klingt nach dem Drehbuch für einen Hollywood-Film: Ein 14-Jähriger, noch zart und ohne Bart, muss nach dem Tod seines Vaters dessen Firma übernehmen, eine kleine, hoch verschuldete Stahlschmiede. Wenige Jahrzehnte später ist daraus das größte Industrieunternehmen Europas geworden – und aus dem Jungen ein steinreicher, berühmter Mann.
Die Rede ist von Alfred Krupp (1812 bis 1887), dem bedeutendsten Unternehmer im jungen Kaiserreich. Dessen Geschichte ist wirklich wahr und nicht von einem Drehbuchautor erdacht.
Wer war Alfred Krupp?
Essen, im Oktober 1826. Was für ein Erbe: eine windschiefe Schmiede, sieben Mitarbeiter und Schulden. Viele Schulden. Doch Alfred Krupp – 14 Jahre, ohne Abitur und Studium – fuchst sich nach dem plötzlichen Tod seines Vaters schnell in die neuen Aufgaben ein. Er ist klug, findig und weiß, wer ihm mit Geld und Rat zur Seite stehen kann.
Und er ist ehrgeizig, ja verbissen. Krupp, hager und hochgewachsen, will die besten Stahlprodukte der Welt fertigen. Und tatsächlich: Walzen, Meißel und Münzstempel verkaufen sich bald bis ins Ausland. Aber erst der Eisenbahnbau bringt seine Fabrik so richtig in Fahrt.
1835 schnaubt erstmals ein Zug in Deutschland, auf der Strecke zwischen Nürnberg und Fürth. Alfred Krupp, nun Mitte 20, wittert gute Geschäfte. Als einer der Ersten in Deutschland lässt er darum seine Männer Federn, Wagenachsen und einen bruchsicheren Radreifen ohne Schweißnaht schmieden – die er ab 1850 in großen Mengen verkauft. Krupp versiebenfacht seine Belegschaft in den kommenden zehn Jahren, er fährt Millionengewinne ein.
Sein Geld verleiht ihm Einfluss und Macht, wie sie früher nur Adlige besaßen. Ab 1859 produziert der nun fast 50-Jährige auch Kanonen für Preußen und andere Länder. Der preußische König bietet ihm zum Dank für seine Verdienste einen Adelstitel an. Krupp lehnt dankend ab. Der Erfolg adele ihn genug, sagt er.
Einen Adelstitel brauche er nicht: "Ich heiße Krupp, das genügt"
Die Geschäfte gehen so gut, dass Krupp ständig neue Leute einstellen, ständig bauen muss. Und er ist nicht der Einzige in der Region. Es ist, als wüte im 19. Jahrhundert ein Virus im Ruhrgebiet. Ein Virus, das alles Grün ergrauen lässt. Wo vor einigen Jahren noch Felder und Wiesen waren, zerschneiden nun Straßen und Schienenstränge das wellige Land. Hohe Fabrikschlote stoßen gegen den ewig verrauchten Himmel. Ständig zittert die Erde – unter den Schlägen Dutzender Dampfhämmer, die den Stahl formen.
Das Gebiet an den Flüssen Ruhr und Emscher ist in nur wenigen Jahrzehnten zu einer Industrieregion geworden. Tausende Menschen strömen voller Hoffnung auf ein leichteres Leben vom Land in die Stadt. Statt Felder zu bestellen und Tiere zu füttern, fördern sie Kohle in den Zechen oder bedienen Maschinen in den Fabriken.
Zehn, elf Stunden buckeln sie jeden Tag, sehen kein Sonnenlicht, riskieren ihre Gesundheit an den glutheißen Hochöfen oder tonnenschweren Hämmern. Nein, leichter haben es viele nicht. Hinzu kommt die Wohnungsnot in den zu klein gewordenen Städten wie Essen. Teils zu zehnt leben die Menschen dort in winzigen Zimmern.
Alfred Krupp fürchtet, dass er bald keine Arbeiter mehr finden und sein Werk nicht weiterwachsen kann. Schon 1856 lässt er darum ein eigenes Wohnheim bauen, ab 1863 kommen weitere Wohnblöcke hinzu. Überall gilt eine strenge Hausordnung. Wer mit dreckigen Händen im Speisesaal erscheint, bekommt Ärger. Der große Erfolg lässt den Fabrikanten nicht gelassener und ruhiger werden. Ganz im Gegenteil.
Alfred Krupp: "Auf meinem Boden will ich Herr sein und bleiben"
Krupp entwickelt sich zum Arbeitssüchtigen, er kennt nur noch die Fabrik. Seine Frau Bertha und der einzige Sohn Friedrich Alfred leben mit ihm mitten auf dem Gelände, eingehüllt vom Qualm der Fabrikschlote, genervt von den Hammerschlägen, die nachts das Geschirr in den Schränken zerspringen lassen. Nur Alfred Krupp hört darin Musik, "mehr als wenn alle Geigen der Welt spielen", sagt er einmal.
Er wird auch zunehmend misstrauischer. Jedem Werksbesucher unterstellt er Spionage. Kommt ein Arbeiter morgens auch nur fünf Minuten zu spät zur Arbeit, lässt er ihm den Lohn für eine Stunde abziehen. Die Männer müssten schließlich gezähmt und überwacht werden, findet er. Mitspracherechte, wie sie die Arbeiter und ihre Partei SAP in den späten 1870er-Jahren einfordern, hält er für eine dumme, überflüssige Mode. In der Fabrik will er "Herr sein und bleiben". Wer auch nur sozialdemokratische Zeitungen liest, wird sofort gefeuert. Einerseits.
Andererseits gibt Krupp sich aber auch sehr fürsorglich gegenüber seiner Belegschaft, baut eben Wohnungen und Schulen für sie, Bier- und Bücherhallen. Er richtet eine Betriebskrankenkasse und Rentenversicherung ein, die die Arbeiter bei Krankheit und im Alter unterstützt – lange vor dem Staat, der erst ab 1883 mit den Sozialgesetzen unter anderem eine staatliche Krankenkasse einführt. Wie passt das zusammen?

Krupps Wohltaten sind kühle Berechnung
Er verlangt für diese Unterstützung von seiner Belegschaft Treue, Fleiß und Gehorsam. Immerhin diese Rechnung geht auf: Nie gibt es Streiks oder Aufstände. Doch 1873 steckt Alfred Krupps Werk plötzlich in einer schlimmen Krise. Er hat alles Geld in die Fabrik gesteckt, die nun so groß ist, dass die Stadt Essen nur noch wie ein Anhängsel des Werksgeländes wirkt. Aber er hat nichts für Krisenzeiten zurückgelegt. Erst nachdem Kaiser Wilhelm I. ein gutes Wort für ihn einlegt, gewähren die Banken Krupp neue Kredite.
Die Firma ist gerettet – und damit auch die "Villa Hügel", in die er im Januar 1873 mit Frau und Sohn zieht. Es ist ein herrschaftliches Anwesen oberhalb des Essener Baldeney-Sees, 269 Zimmer, beheizt von einer modernen Zentralheizung. Doch die funktioniert nicht richtig. Es zieht in den Fluren, jeder friert.
Völlig entnervt von der Kühle des Hauses und der ihres Mannes, von dessen Herrschsucht und den Streitereien, zieht Bertha Krupp schon bald wieder aus. Alfred Krupp, der erfolgreiche Stahlbaron, verbringt die folgenden Jahre daher meist allein in seiner zugigen Villa. Am 14. Juli 1887 stirbt er mit 75 Jahren. Kein Happy End – anders als in den meisten Hollywood-Filmen.