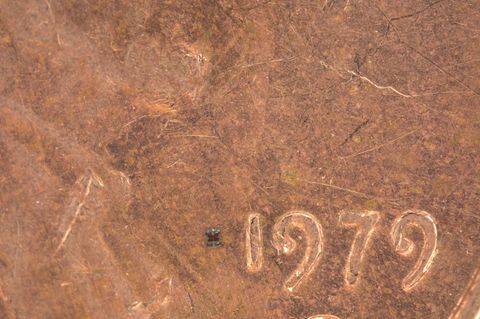Aus den einfachen Komponenten Zement, Wasser und Ruß haben US-Wissenschaftler*innen einen Stromspeicher entwickelt. In das Fundament eines Hauses eingelassen, könnten 45 Kubikmeter des Materials rund zehn Kilowattstunden speichern, was etwa dem durchschnittlichen Tagesverbrauch eines Haushalts in den USA entspricht. Auch den Einbau in Straßen, der – zumindest in der Theorie – das Laden von Elektrofahrzeugen während des Fahrens ermöglichen würde, können sich die Autor*innen der Studie vorstellen.
Bislang sind Batterien auf knapper werdende Bestandteile wie etwa Lithium angewiesen. Um elektrischen Strom in größerem Umfang zu speichern und die Energiewende voranzutreiben, müssten gut verfügbare Materialien für Energiespeicher verwendet werden, betonen die Forschenden vom Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Die Speicherung elektrischer Energie in Beton wird seit einigen Jahren erforscht. Die nun erschienene Studie zeigt einen Weg, aus Zement, Wasser und Ruß einen Superkondensator herzustellen. Grundsätzlich sind in einem Kondensator zwei stromleitende Elektroden durch nicht leitendes Material getrennt. Im geladenen Zustand ziehen sich die negativen Ladungsträger in der einen Elektrode und die positiven Ladungsträger in der anderen Elektrode an, sie können wegen des Nichtleiters aber nicht zusammenkommen. Dieser Aufbau ermöglicht eine sehr lange Speicherung elektrischer Energie.
Betonmischung als Heizsystem?
Die Forschenden stellten zunächst eine Mischung aus Portlandzement und Ruß her, wobei der Ruß sehr porös war und Strukturen im Bereich von Nanometern (Millionstel Millimetern) aufwies. Mit viel Wasser angerührt, entstand ein ebenfalls poröses Material, in dem sich der wasserabweisende Ruß selbstständig in leitfähigen Nanometerdrähten anordnet. Die Hohlräume des porösen Materials wurden mit einem Elektrolyten mit Kaliumchlorid gesättigt, der Ladungsträger zur Verfügung stellt. Die große Oberfläche des porösen Rußes führt zu einer hohen Speicherkapazität.
"Man kann von ein-Millimeter-dicken Elektroden auf ein-Meter-dicke Elektroden umsteigen und auf diese Weise die Energiespeicherkapazität skalieren, von der Beleuchtung einer LED für ein paar Sekunden bis hin zur Stromversorgung eines ganzen Hauses", wird Franz-Josef Ulm, einer der Autoren der Studie, in einer Mitteilung des MIT zitiert. Auch lasse sich die Kapazität des Energiespeichers steigern, wenn man eine geringere Festigkeit in Kauf nimmt. Das Material ist dann jedoch nicht für Fundamente oder Straßen geeignet.
Neben der Fähigkeit zum Speichern von Strom könne dieselbe Art von Betonmischung auch als Heizsystem verwendet werden. Dazu müsse man Strom an den kohlenstoffhaltigen Beton anlegen, erklären die Forscher.
Sie hoffen außerdem, dass die neuen Superkondensatoren den großen ökologischen Fußabdruck der Zementherstellung teilweise ausgleichen könnten. Die Zementproduktion ist derzeit für etwa acht Prozent des weltweiten Ausstoßes des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) verantwortlich.