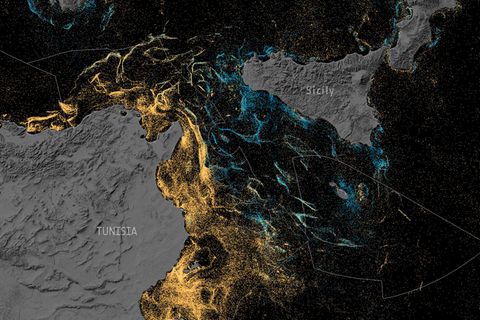Im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts sind sich die Lachspopulationen in der Ostsee genetisch immer ähnlicher geworden. Grund dafür sei die gängige Praxis, Zuchtlachse ins Freiland auszusetzen, um die durch Umweltzerstörung und den Bau von Wasserkraftanlagen bedrohten natürlichen Bestände aufzustocken, berichtet ein internationales Forscherteam in den "Proceedings B" der britischen Royal Society.
Die genetische Vereinheitlichung der Lachse mindere womöglich ihre Fähigkeit, sich an wechselnde Umweltbedingungen anzupassen. Die Studie weise auf die Langzeitfolgen einer weltweit verbreiteten Praxis hin.
Überfischung und Umweltverschmutzung gefährden Bestände
Der Atlantische Lachs (Salmo salar) verbringt den Großteil seines erwachsenen Lebens im Meer, im Atlantischen Ozean. In der Ostsee lebt eine Unterart. Zum Laichen ziehen die Tiere im Herbst in die Oberläufe der Flüsse Europas und Nordamerikas. Die Junglachse wandern dann im Alter von etwa zwei Jahren zurück ins Meer, bis sie nach einigen Jahren an ihre Geburtsorte zurückkehren, um selbst dort zu laichen.
Im vergangenen Jahrhundert gingen die Lachsbestände vielerorts zurück, auch in der Ostsee. Überfischung und Umweltverschmutzung bedrohen die Tiere, vor allem aber der Bau von Wasserkraftanlagen, die die natürlichen Wanderungen der Lachse in den Flüssen behindern.

Ursprünglich seien Junglachse aus mindestens 80 Flüssen in die Ostsee gewandert, schreiben die Wissenschaftler um Johan Östergren von der Swedish University of Agricultural Sciences. Heute seien es nur noch 28. 16 dieser Flüsse gehörten zu Schweden, aus ihnen stammten rund 90 Prozent der Junglachse in der Ostsee.
Fünf Millionen Junglachse werden pro jahr ausgesetzt
Um die Verluste auszugleichen, würden jährlich etwa fünf Millionen Junglachse - als Smolts bezeichnet - ausgesetzt, sie machen rund 60 Prozent der dortigen Junglachse aus. Diese Praxis sei das "umfangreichste und längste Aufstockungsexperiment der Welt", schreiben die Forscher.
"Die Lachsaufzuchtanlagen werden von den Kraftwerksbetreibern unterhalten, sie sind gesetzlich dazu verpflichtet", erläutert Harry Vincent Strehlow vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock, der nicht an der Studie beteiligt war. "Die zum Laichen aufsteigenden Lachse werden abgefangen, die Eier werden abgestreift und dann in Fischbrutanstalten bebrütet und aufgezogen." Nach etwa zwei Jahren werden die Smolts meist in die Mündungsgebiete der Flüsse zurückgesetzt.
Die Wissenschaftler um Östergren wollten nun herausfinden, ob die jahrzehntelange Praxis das Erbgut der Lachse verändert hatte. Dazu analysierten sie charakteristische Genbereiche von 1680 Lachsen aus 13 schwedischen Flüssen. In acht dieser Gewässer laichen Lachse noch natürlicherweise, in fünf findet gar keine natürliche Vermehrung mehr statt.
Das Erbgut gewannen die Forscher zum einen aus getrockneten Schuppen, die seit 1920 in Museen gesammelt worden waren, zum anderen aus heute in Flüssen gefangenen Tieren.
Populationen haben sich in den letzten Jahrzehnten genetisch stark angenährt
Die Auswertung ergab, dass sich ein Großteil der untersuchten Populationen genetisch im Verlauf der letzten Jahrzehnte immer stärker angenähert hatten. Die Forscher führen dies darauf zurück, dass infolge der Freisetzung von Junglachsen durch den Menschen der Genfluss zwischen den verschiedenen Populationen zugenommen hat, diese sich folglich immer stärker ähnelten.
Innerhalb einzelner Populationen nahm die genetische Vielfalt zu, wiederum weil neue Gene durch die Zuchtlachse in die Populationen eingebracht wurden. Die besonders großen Bestände zeigten weniger Veränderungen, vermutlich weil darin mehr eigene Junglachse heranwuchsen.
Zu Beginn der Aufzucht von Lachsen seien noch heimische Fische als Brutstöcke genutzt worden, erläutern die Forscher. Zunehmend seien aber in allen Aufzuchtstationen nicht-heimische Tiere genutzt worden, um eine verlässliche Nachzucht garantieren zu können. Dies habe zur Vereinheitlichung des Genpools beigetragen.
Zuchtlachsen fehlt die Prägung für einen festgelegten Geburtsort
Wenn die Zuchtlachse direkt ins Meer - und nicht in Flüsse - freigesetzt würden, komme ein weiteres Problem hinzu: Diesen Lachsen fehlt die Prägung für einen festgelegten Geburtsort, an den sie selber zum Laichen wandern. Sie "streunen" deshalb herum, und verteilen ihre Genmerkmale weitläufig. Dies wurde nach Angaben der Forscher vor allem in den 1980er und 90er Jahren praktiziert.
Die genetische Vereinheitlichung beeinträchtige die Fitness der Tiere auf individueller Ebene und auf Populationsebene, schreiben die Forscher. Lokale genetische Anpassungen würden, zumindest kurz- bis mittelfristig, durch nicht-angepasste Genvarianten ausgetauscht, was die Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen Umweltveränderungen verringern dürfte.
Denkbar ist, dass etwa lokale genetische Anpassungen an höhere Wassertemperaturen verloren gehen könnte, die in Zeiten des Klimawandels nützlich sein könnten. Für die Lachspopulationen in der Ostsee habe die genetische Homogenisierung wahrscheinlich zu negativen biologischen Konsequenzen geführt, fassen die Forscher zusammen.
Bei der Lösung des Problems würde eine gemeinsame, wissenschaftlich fundierte Brut- und Freilassungsstrategie in der gesamten Ostsee helfen, sagte Östergren der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn diese auch angepasst wäre an die Möglichkeiten der Fischerei, den Hauptteil der freigelassenen Brutfische auch tatsächlich wieder zu fangen und zu ernten, dann wäre das Problem weniger bedeutend."
Da große Flüsse, beziehungsweise große Populationen eine gewisse Widerstandskraft gegen die Übertragung von Genen zu haben scheinen, sei es zudem wichtig, die Wildlachspopulationen so groß wie möglich zu halten.
"Im Grunde besitzt jeder Fluss eine eigene Subpopulation, die über eigene, an den jeweiligen Lebensraum angepasste Merkmale verfügt", sagt Strehlow. Eine genetische Verarmung könne zum Verlust dieser Vielfalt und damit auch des Anpassungsvermögens führen. Ob die Praxis des Aussetzens von Jungfischen langfristig Bestand hat, sei fraglich.
"Die EU-Kommission verlangt über kurz oder lang den Erhalt von Wildpopulationen", sagt Strehlow. "Das ist mit dem Betrieb von Wasserkraftanlagen nicht vereinbar." Wenn man die Bestände erhalten wolle, sei es sinnvoll, die Lebensräume der Lachse in den Flüssen zu verbessern, etwa indem man Wehre zurückbaut oder Kiesbetten zum Laichen anlegt. "Damit kann man viel erreichen."