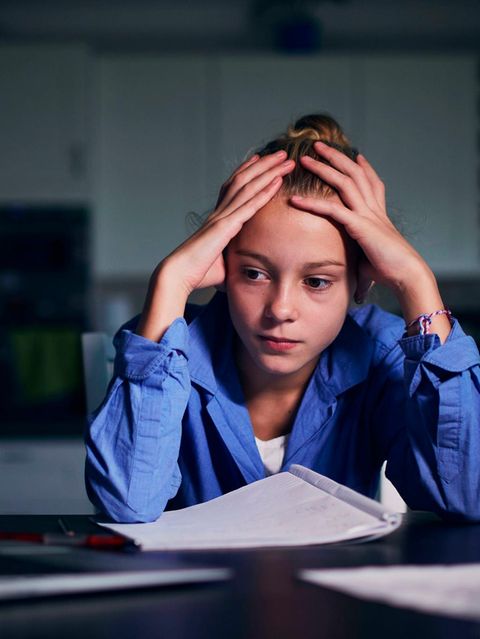Manche Menschen stehen auf der Bühne, erhalten Auszeichnungen, führen Teams, halten Konferenzen am Laufen – und glauben dennoch, dass sie nicht dazugehören. Als hätten sie sich in ein Leben eingeschlichen, das ihnen nicht zusteht. Der Applaus ist da, das Lob ist da, sogar der objektive Erfolg. Und doch bleibt der Gedanke: Irgendwann fliegt das alles auf. Dann merkt man, dass ich gar nichts kann.
Das sogenannte Impostor-Syndrom beschreibt ein psychologisches Paradox: Menschen, die tatsächlich kompetent sind, erleben sich selbst als Hochstapler. Statt stolz zu sein, werten sie ihre Leistungen ab. Sie glauben, andere würden sie überschätzen, und jede neue Herausforderung wird zur inneren Zerreißprobe – als müssten sie ihren Platz in der Welt immer wieder neu rechtfertigen.
Was bleibt, ist das nagende Gefühl, ein Glücksfall, ein Zufallsprodukt, ein Missverständnis zu sein. Damit beschreibt das Impostor-Syndrom das glatte Gegenteil des Dunning-Kruger-Effekts, der die völlige Selbstüberschätzung inkompetenter Personen bezeichnet.
Psychologisch betrachtet ist das Impostor-Syndrom keine Krankheit, sondern ein verbreitetes Muster von Selbstzweifeln. Und es ist erstaunlich robust: Sogar nach Jahren im Beruf, nach bestandenen Prüfungen und sichtbaren Erfolgen lässt es sich nicht so einfach abschütteln.
Welchen Ursprung hat das Impostor-Syndrom?
Geprägt wurde der Begriff Impostor Phenomenon 1978 von den amerikanischen Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Imes. In ihrer Arbeit mit Studentinnen fiel ihnen auf, dass selbst hochbegabte Frauen ihre Leistungen systematisch kleinredeten. Seither ist viel geforscht worden – und es zeigt sich: Nicht nur Frauen sind betroffen, auch Männer, Kinder und Menschen in Führungspositionen kennen das Gefühl, sich fremd im eigenen Erfolg zu fühlen.
Mittlerweile raten viele Fachleute sogar davon ab, von einem "Syndrom" zu sprechen, weil der Begriff eine psychische Störung suggeriert. Stattdessen sei das Impostor-Erleben eher ein Persönlichkeitsmerkmal – ein inneres Muster, das sich mit der Zeit verfestigt.
Typisch ist dabei ein ständiges Hin und Her: Zwischen hoher Anstrengung und tiefer Selbstzweifel. Zwischen äußerer Anerkennung und innerem Rückzug. Betroffene arbeiten oft über das gesunde Maß hinaus – oder schieben Aufgaben so lange vor sich her, bis der Perfektionsdruck lähmt. Und wenn sie etwas gut gemacht haben? Dann war es eben Glück. Oder Zufall. Oder die Hilfe anderer. Fast nie: sie selbst. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung zumindest phasenweise von starken Impostor-Gefühlen betroffen sind. Manche lernen, damit zu leben. Andere werden regelrecht krank.
Was können Selbstzweifel anrichten?
Denn das Impostor-Gefühl bleibt selten folgenlos. Was nach außen wie übertriebene Bescheidenheit wirkt, ist nach innen oft ein permanenter Ausnahmezustand. Die Angst, nicht zu genügen, sorgt für ein Leben im Hochleistungsmodus – oder im Dauerstress des Aufschiebens. Beides zehrt. Wer seine Erfolge nicht als eigene Errungenschaft verbuchen kann, hat keine stabile Grundlage, auf der Selbstvertrauen wachsen könnte. Jede neue Aufgabe wird zur Prüfung. Jede Pause zum Risiko.
Auf Dauer kann dieser innere Druck krank machen. Studien zeigen, dass Menschen mit stark ausgeprägtem Impostor-Erleben häufiger unter Erschöpfung, Schlafstörungen und depressiven Verstimmungen leiden. Besonders tückisch: Der Erfolg selbst wird zur Belastung. Denn mit jedem Schritt nach oben wächst auch die Angst, bald aufzufliegen.
Wie entsteht das Hochstaplergefühl?
Der Ursprung des Impostor-Gefühls liegt oft in der Kindheit – und nicht selten in einem übermäßig leistungsorientierten Umfeld. Wer früh lernt, dass Anerkennung an Bedingungen geknüpft ist – gute Noten, sportliche Erfolge, perfektes Verhalten – verinnerlicht oft unbewusst die Idee, dass er oder sie nie genug ist. Auch übermäßig kritische oder wenig emotional präsente Bezugspersonen können dazu beitragen, dass sich Kinder später als Erwachsene schwer damit tun, sich selbst Wert zuzuschreiben.
Ebenso kann es Menschen treffen, die aus einem Umfeld stammen, in dem Erfolg nicht selbstverständlich war. Wer als Erste in der Familie studiert, wer sich in einer neuen sozialen Schicht wiederfindet oder durch Quotenregelungen gefördert wird, erlebt die eigene Position mitunter als fragil.
Hinzu kommen gesellschaftliche Einflüsse: permanente Vergleichbarkeit, hoher Konkurrenzdruck, die neue Unschärfe zwischen eigener und technischer Leistung. Besonders digitale Werkzeuge wie KI können das Gefühl verstärken, den eigenen Beitrag nicht klar benennen zu können.
Was hilft gegen Impostor-Gefühle?
Ganz verschwindet das Gefühl, nicht zu genügen, vielleicht nie. Aber es lässt sich zähmen. Der erste Schritt: ihm einen Namen geben. Wer erkennt, dass die nagenden Zweifel kein persönliches Versagen, sondern ein verbreitetes psychologisches Muster sind, kann sich innerlich distanzieren. Das macht den inneren Kritiker nicht mundtot – aber weniger bedrohlich.
Hilfreich ist es, die eigene Leistung sichtbar zu machen. Manche führen ein Erfolgstagebuch, andere sammeln positive Rückmeldungen, Zertifikate, Projektabschlüsse – nicht aus Eitelkeit, sondern als Gegengewicht zur inneren Selbstabwertung. Auch Gespräche mit vertrauten Menschen können den verzerrten Blick zurechtrücken. Was man selbst für "nichts Besonderes" hält, ist aus der Perspektive anderer oft beeindruckend.
Psychotherapeutisch lässt sich das Impostor-Erleben gut bearbeiten, etwa im Rahmen kognitiver Verhaltenstherapie. Dort geht es nicht darum, die Stimme des Zweifels zu verdrängen – sondern sie zu überprüfen. Ist das wirklich wahr, was ich über mich denke? Gibt es Belege für das Gegenteil? Auch eine systemische Sichtweise kann helfen: Sie erlaubt, die familiären und sozialen Prägungen zu hinterfragen, aus denen das Muster entstanden ist.
Und nicht zuletzt sind auch Führungskräfte gefragt. Echtes, differenziertes Feedback – jenseits von bloßem Schulterklopfen – kann enorm wirksam sein. Wer erklärt, was genau gelungen war und warum, schafft Orientierung und baut Vertrauen auf. Denn Menschen mit Impostor-Gefühlen brauchen vor allem eines: die Erlaubnis, gut sein zu dürfen.
5 Strategien gegen das Impostor-Gefühl
1. Erfolge sichtbar machen
Führen Sie ein Erfolgstagebuch, notieren Sie, was Ihnen gelungen ist, und welche Fähigkeiten Sie dabei eingesetzt haben. Hängen Sie Zertifikate, Projektabschlüsse oder positive Rückmeldungen nicht weg – sondern dorthin, wo Sie sie regelmäßig sehen. Das stärkt die Erinnerung daran, dass Ihr Erfolg kein Zufall war.
2. Das Impostor-Gefühl benennen
Allein die Erkenntnis, dass es sich um ein bekanntes, weit verbreitetes psychologisches Muster handelt, hilft vielen Betroffenen. Wer das versteht, kann sich innerlich distanzieren – und fühlt sich weniger allein mit seinen Zweifeln.
3. Innere Überzeugungen prüfen
Achten Sie auf automatische Gedanken wie: Das hätte jeder gekonnt oder Ich hatte nur Glück. Hinterfragen Sie sie bewusst: Ist das wirklich so? Was spricht dagegen? Gibt es Hinweise dafür, dass ich diese Aufgabe mit Kompetenz bewältigt habe? Mit etwas Übung lässt sich der innere Kritiker entwaffnen.
4. Mit anderen sprechen
Offene Gespräche mit Kolleginnen oder Freunden können enorm entlastend sein. Oft stellt sich heraus: Auch andere zweifeln – und das schmälert weder ihre Leistung noch ihre Berechtigung. Im Austausch wächst Vertrauen in die eigene Perspektive.
5. Feedback richtig geben (und annehmen)
Pauschales Lob verpufft oft. Hilfreicher ist konkrete Anerkennung: Ihre Argumentation war klar strukturiert und hat das Team überzeugt. Führungskräfte sollten differenziert und ehrlich loben – und konstruktiv kritisieren. Das macht Rückmeldungen glaubwürdig und stärkt das Selbstbild der Betroffenen nachhaltig.