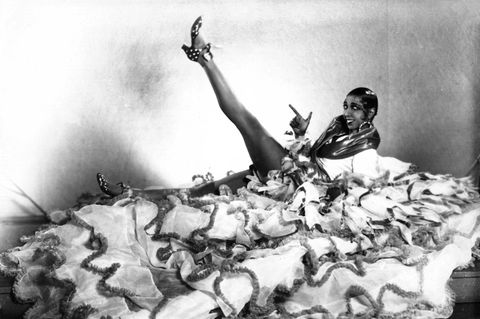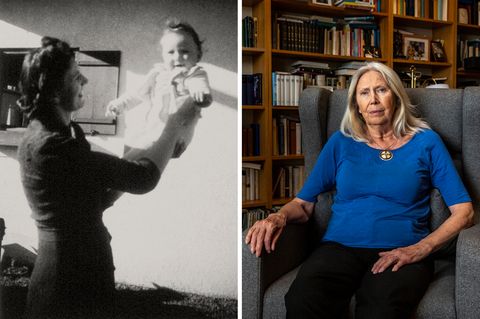"Wir, die Völker der Vereinten Nationen, haben beschlossen zusammenzuwirken." Mit diesem Satz beginnt die Charta der UN, die die Führer von 51 Staaten am 26. Juni 1945 in San Francisco unterschrieben. Während im pazifischen Raum noch gekämpft wurde, verpflichteten sich die Erstunterzeichner dazu, "künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren". In den folgenden Jahrzehnten wuchs die UN, etwa als in den 1960er-Jahren die Kolonialreiche zerfielen und viele neue Staaten entstanden. Zuletzt kam 2011 der Südsudan hinzu.
Heute sind mit 193 Staaten fast alle Länder der Welt Mitglieder der UN. 80 Jahre nach ihrer Gründung blickt die Organisation auf viele Erfolge zurück, aber auch auf Niederlagen. Ein Überblick über Erfolge und Misserfolge in der Geschichte der Vereinten Nationen.
Weltverfassung
Auch wenn sie nicht immer umgesetzt wird, gilt die Charta der UN heute als eine Art Weltverfassung. Sie verbietet es etwa Staaten, ihre Interessen mit Gewalt oder deren Androhung durchzusetzen. Nur wenn sie sich selbst verteidigen müssen, gilt eine Ausnahme.

Bis auf den Vatikan und einige Gebiete mit begrenzter Anerkennung wie Palästina oder Südossetien sind heute alle Staaten in der UN als Mitglieder vertreten. Dadurch bietet sie einen einzigartigen Raum für Diplomatie. So trugen die Vereinten Nationen wesentlich zur Entschärfung der Kubakrise bei und halfen so, einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Auch andere Konflikte wie etwa der Bürgerkrieg in Sierra Leone 2002 konnten mithilfe der UN befriedet werden. Für ihr Engagement erhielt die Organisation deshalb 2001 den Friedensnobelpreis.
Große Ziele
Für die UN bedeutet Frieden jedoch nicht nur die Abwesenheit von Krieg: Schon drei Jahre nach ihrer Gründung unterzeichneten die Mitglieder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die bis heute Mindeststandards etwa für Freiheit, soziale Gerechtigkeit und körperliche Unversehrtheit setzen. So ist es der Weltgesundheitsorganisation der UN gelungen, mit einer groß angelegten Impfkampagne die Pocken auszurotten. Und das Welternährungsprogramm hat allein im Jahr 2021 fast 130 Millionen Menschen mit Essen versorgt.
Aber nicht alles gelingt: 2015 haben die UN-Mitglieder einstimmig 17 nachhaltige Entwicklungsziele beschlossen. Sie sehen vor, dass die Staaten ihren Bürgern bis 2030 ein Leben ohne Armut, Hunger und übermäßige Ausbeutung des Planeten ermöglichen. Trotz einiger Fortschritte erscheinen diese Ziele heute nicht mehr realistisch.

Völkermord trotz UN-Mission
Auch haben es die Vereinten Nationen in mehreren ihrer Friedensmissionen nicht geschafft, massive Gewaltausbrüche zu verhindern. Als Hutu-Stammesmitglieder in Ruanda 1994 Hunderttausende Menschen abschlachteten, konnten die dortigen Blauhelmsoldaten nicht eingreifen, weil sie zu Neutralität verpflichtet waren. Nachdem auch zehn der Soldaten getötet worden waren, zogen sich die UN-Kräfte ganz aus dem Land zurück. Im folgenden Jahr waren UN-Soldaten serbischen Truppen so unterlegen, dass die 8000 Menschen in Srebrenica ermorden konnten. Seit diesen Ereignissen setzen etwa NATO und EU verstärkt auf eigene Friedensmissionen wie im Kosovo.
Dass das Mandat von UN-Truppen mitunter nicht weit genug reicht, liegt auch an der Struktur der Vereinten Nationen selbst. Die 193 Mitglieder der Generalversammlung verstricken sich häufig in lange Diskussionen, an deren Ende Minimalkompromisse stehen. Außerdem kann die Generalversammlung ihre Mitglieder zu nichts zwingen, sondern nur unverbindliche Aufforderungen und Erklärungen formulieren. Vor diesem Hintergrund setzen sich auch mächtige Staaten immer wieder über das Angriffsverbot der UN-Charta hinweg, etwa die USA im Irak und Russland in der Ukraine.
Blockade im Sicherheitsrat
Der Sicherheitsrat kann dagegen bindende Maßnahmen beschließen und auch offensive Militäreinsätze erlauben, so geschehen bei den Luftangriffen auf die Truppen Muammar al-Gadaffis in Lybien 2011. Aber die damalige Einigkeit ist eher die Ausnahme, denn im Sicherheitsrat hat jedes der fünf ständigen Mitglieder ein Vetorecht. Während des Kalten Krieges war das Gremium daher weitgehend gelähmt, weil die USA und die Sowjetunion alle Vorschläge des jeweils anderen blockierten.

Nach 1990 lockerte sich die Blockade zwar vorübergehend – so beschloss der Sicherheitsrat etwa Friedensbedigungen im ersten Golfkrieg. In den vergangenen Jahren blockierten aber etwa die USA wieder viele Resolutionen der anderen Sicherheitsratsmitglieder zu Israel, und Russland verhindert alle kritischen Erklärungen zu seiner Rolle im Ukraine-Krieg.
Schließlich erscheint auch die Zusammensetzung des Rates mit den USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China als ständigen Mitgliedern zunehmend wie ein Relikt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwar wurde die Zahl der nicht ständigen Mitglieder schon 1966 auf zehn erhöht. Aber grundlegendere Reformen, die etwa afrikanischen und südamerikanischen Staaten mehr Einfluss verleihen, werden bereits seit mehr als 20 Jahren diskutiert. Bisher ohne Ergebnis.