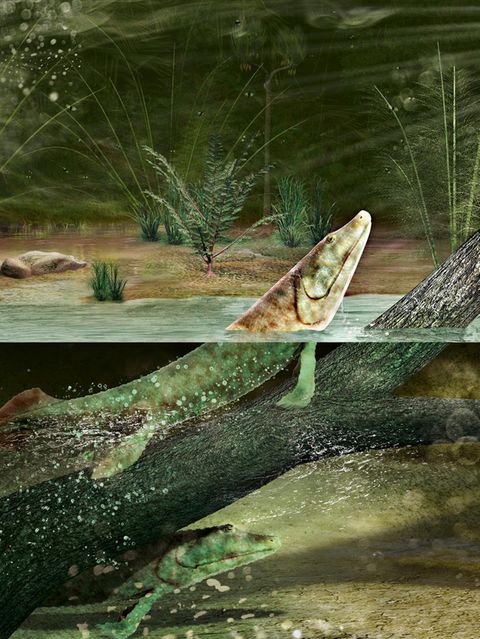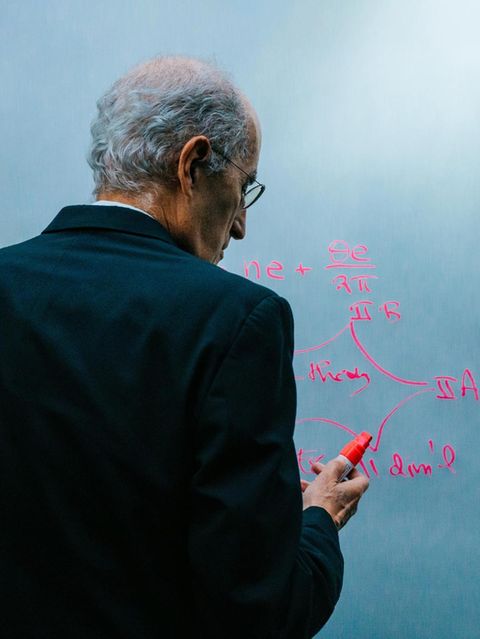Sojabohnen können sehr nachtragend sein. Werden sie gestresst, vergessen sie das nicht. Und ihre Nachkommen auch nicht. Wie Forschende der "Arkansas Agricultural Experiment Station" herausgefunden haben, geben die Hülsenfrüchte negative Erfahrungen an ihre Sprösslinge weiter.
Die Ergebnisse des Teams unter Leitung von Rupesh Kariyat wurden in mehreren Studien publiziert und in einer Pressemitteilung zusammengefasst. Sollten sie sich bestätigen, hätte dies beträchtliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft – und den Hobbygarten.
Fressfeinde prägen Sojabohnen über Generationen
Das Team unter Leitung von Rupesh Kariyat experimentierte zwei Jahre lang mit Sojabohnen. Mal ließ es Fressfeinde auf sie los – den südamerikanischen Eulenfalter Chrysodeixis includens und den Herbst-Heerwurm; mal simulierte es Dürre, mal alles zugleich. Die Pflanzen setzten sich wie erwartet gegen die Stressoren zur Wehr. Sie wuchsen kräftiger, bildeten mehr Blüten oder Verteidigungshaare (Trichome).
Überraschend war jedoch, dass auch die Nachkommen der gestressten Pflanzen diese Anpassungen zeigten; selbst wenn sie dem Stress nie ausgesetzt waren. Die Eltern hatten ihren Sprösslingen offenbar eine Warnung übermittelt.
Mittels Epigenetik werden Informationen an die Nachkommen vererbt
Dieser Effekt wird "transgenerationale Plastizität" genannt. Die Forschenden vermuten, dass er auf epigenetische Vererbung zurückgeht. Zum Verständnis: An der DNS der Pflanzen ändert sich dabei nichts. Sehr wohl aber an speziellen Markierungen entlang des DNS-Stranges. Diese Markierungen beeinflussen, welche Gene abgelesen werden und welche nicht. So ermöglichen sie der Pflanze, sich an Umweltbedingungen anzupassen.
Indem Eltern die epigenetischen Markierungen an Nachkommen weitergeben, können sie diesen Informationen übermitteln. Darüber hinaus scheinen gestresste Mutterpflanzen zudem proteinreichere Samen zu produzieren. Vermutlich, um ihren Sprösslingen bessere Startchancen zu garantieren.
Unterschiedlicher Stress hinterlässt jeweils andere Prägungen
Als Nächstes wollten die Forschenden wissen, ob sich die verschiedenen Arten von Stress unterschiedlich auf die Nachkommen auswirken. Tatsächlich: Nachkommen von Sojapflanzen, die sowohl unter Dürre als auch Insektenfraß gelitten hatten, waren robuster und produzierten besonders viele Blüten und proteinreiche Samen. Allerdings waren sie auch dicht von Haaren bewachsen. Diese Widerborstigkeit ging offenbar auf Kosten des Ertrags. Zahlreiche Schoten blieben leer.
Anders sah es bei Pflanzen aus, die nur mit Insektenfraß zu kämpfen hatten. Fiel erst der Eulenfalter und später der Herbst-Heerwurm über die Sojabohne her, bildeten die Nachkommen mehr Blüten und Schoten und hatten einen höheren Proteingehalt, als wenn die Insekten in umgekehrter Reihenfolge auftraten. Auf die Behaarung hatte der Befall keine Auswirkung.
Saatgutoptimierung mittels Stress ist ein zweischneidiges Schwert
Studienleiter Kariyat betont an dieser Stelle, dass der Klimawandel den Insektenbefall verschärfen wird: "Insekten werden immer größer und durchlaufen jedes Jahr mehrere Generationen. Das führt zu einem erhöhten Einsatz von Pestiziden, was nicht nachhaltig ist." Ließen sich die Erkenntnisse also nutzen, um robustere, ertragreichere Pflanzen zu erzeugen und Pestizide zu sparen?
Kariyat sagt, man müsse genau abwägen: "Es ist nicht so, dass Fressfeinde immer die Leistungsfähigkeit der Pflanzen verbessern, sondern die Art, Schwere und Kombination der Stressfaktoren bestimmen, ob die Reaktionen vorteilhaft oder nachteilig sind."
Gerade das Zusammentreffen unterschiedlicher Stressoren – Dürre und Insektenfraß – in der Elterngeneration könne auch zulasten des Ertrags gehen. Die Tochterpflanze investiere dann mehr Ressourcen in Verteidigung und weniger in Wachstum und Schotenproduktion. Wahrscheinlich gilt dieser Zusammenhang nicht nur für Bohnen, sondern, wie weitere Studien nahelegen, auch für andere Pflanzen. Hier ist weitere Forschung nötig.
Was bedeuten die Ergebnisse für Landwirtinnen und Selbstversorger?
Doch schon jetzt lassen sich aus den Studien erste Schlüsse für die Landwirtschaft ziehen. Viele kleine Farmen in Brasilien und Afrika können sich kein teures, Hochleistungssaatgut leisten und gewinnen ihr Saatgut selbst. Das könnte einerseits ein Vorteil sein, weil die Pflanzen sich so von einer Generation zur nächsten besser an die Bedingungen vor Ort anpassen. Andererseits ist aber auch denkbar, dass zu viele Stressfaktoren den Ertrag dauerhaft schwächen, da die Nachkommen zu viel Kraft in die Verteidigung stecken.
Kariyat selbst kommt zu einem ernüchternden Fazit: "Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse scheint es nachteilhaft zu sein, selbst gewonnenes Saatgut zu verwenden, da mehrere Stressfaktoren den Ertrag in den nachfolgenden Generationen verringern können. Zukünftige Experimente könnten jedoch interessante Lösungen aufzeigen."
Auch viele Hobbygärtner gewinnen ihr Saatgut selbst. Manche sind überzeugt, dass sich "ihre" Bohne speziell an ihren Garten adaptiert hat. Vor dem Hintergrund der Studien ist das nicht völlig abwegig. Allerdings kann die Gewinnung eigenen Saatguts – neben vielen Vorteilen – weitere Nachteile haben: Werden zu wenige Mutterpflanzen auf einmal angebaut, kann es zu Inzuchteffekten kommen. Und mit Krankheitserregern infizierte Pflanzen geben diese über ihre Samen unter Umständen auch an ihre Nachkommen weiter. Ganz ohne Epigenetik.