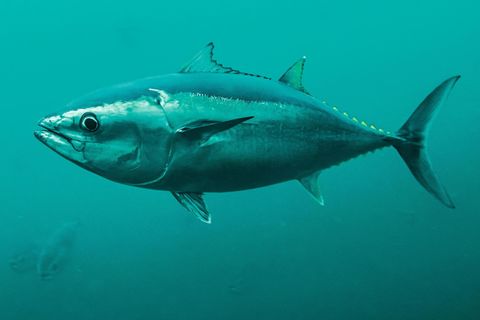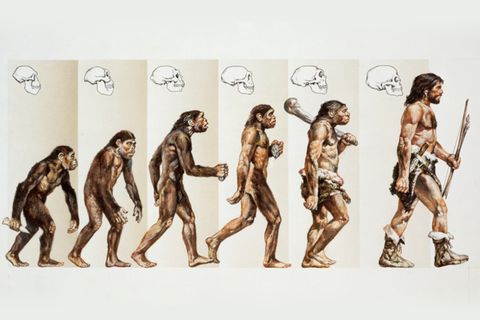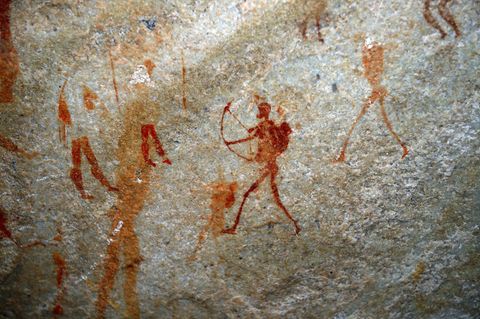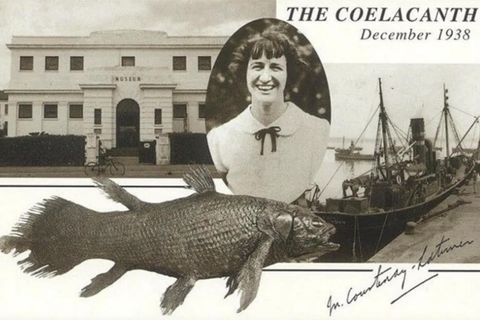Perissodus microlepis ist ein durchgeknalltes Lebewesen. Wie ein Torpedo schießt der Buntbarsch von hinten an andere Fische des Tanganjikasees heran – nur hier, zwischen Tansania und der Demokratischen Republik Kongo ist er zu Hause –, um dann seine scharfkantigen, rückwärtsgewandten Zähne an seinen Opfern entlangzuschleifen. Perissodus microlepis raspelt ihnen die Schuppen ab, seine Lieblingsspeise.
Doch damit nicht genug. Jeder der Buntbarsche hat eine bevorzugte Angriffsseite und richtet seine gesamte Gestalt nach ihr aus. Kopf und insbesondere das Maul der Tiere zeigen entweder nach rechts oder nach links.
Links- und Rechtsköpfer wechseln sich ab
Auf lange Sicht besteht die Buntbarschpopulation im Tanganjikasee etwa zu gleichen Teilen aus Links- und Rechtsköpfern. Betrachtet man allerdings kürzere Zeiträume, verschiebt sich das Bild: Etwa fünf Jahre lang dominiert die eine Seite, dann die andere.
Reiner Zufall? Eine merkwürdige Laune der Natur?
Die Evolutionsbiologin Xiaomeng Tian ist vom Gegenteil überzeugt. Perissodus microlepis, sagt sie, sei ein "Paradebeispiel für eine seltene frequenzabhängige Selektion". Die Population passt sich dabei stets an ihre eigene Zusammensetzung an, jeweils zum Nachteil der im Moment häufigeren Art. "Wenn zum Beispiel die Population von Linksköpfern wächst, achtet ihre Beute verstärkt auf die häufiger attackierte, rechte Seite", erläutert Tian. Damit seien Rechtsköpfer zumindest eine Zeitlang im Vorteil. Sie haben größeren Jagderfolg und damit erhöhte Fortpflanzungschancen.
In einer nun in der Fachzeitschrift "Science Advances" erschienenen Studie erforschten Tian und ihre Kolleginnen und Kollegen von der Universität Konstanz die genetischen Hintergründe der buntbarschigen Asymmetrie. Sie untersuchten 102 Exemplare des Perissodus microlepis, führten umfangreiche Genomanalysen aller Individuen und jeweils eine Mikro-Computertomografie zur dreidimensionalen Analyse ihrer Morphologie durch. Auf diese Weise konnten sie im Genom des Buntbarsches 72 Regionen identifizieren, die mit der Ausbildung der asymmetrischen Kopfform zusammenhängen.

"Vorherige Studien legten nahe, dass es sich bei diesem Polymorphismus um ein einfaches Mendel'sches Merkmal mit bimodaler Verteilung handelt", sagt Forschungsgruppenleiter Axel Meyer. "Unsere Untersuchungen zeigen aber, dass der Fall in Wirklichkeit komplexer ist: Nicht ein einzelnes Gen ist für die Asymmetrie verantwortlich, sondern eine Vielzahl von Genen, die im gesamten Genmaterial verteilt sind."
Bleibt die Frage, was zuerst war: die einseitige Angriffsrichtung der Fische oder die verschobene Kopfform?
"Wahrscheinlich hat sich beides gemeinsam ausgebildet und sich in einer Wechselwirkung gegenseitig verstärkt", sagt Tian. Ein Linksköpfer greift demnach am liebsten von links an, weil er genetisch darauf programmiert ist – und weil er die Erfahrung gemacht hat, auf diese Weise erfolgreicher zu sein. Die Gehirnscans im Konstanzer Labor hätten außerdem gezeigt, dass die Richtungspräferenz im Jagdverhalten teils aus einem asymmetrischen Anschalten der Gene (Genexpression) auf der linken oder rechten Seite im Gehirn hervorgeht.
"Unsere Ergebnisse legen nahe, dass sowohl morphologische als auch verhaltensbezogene Asymmetrien einen messbaren genetischen Anteil haben und eine gemeinsame – oder miteinander verbundene – genetische Basis aufweisen", sagt Forschungsgruppenleiter Meyer. In weiteren Studien wollen er und sein Team nun genauer aufschlüsseln, welche Rolle die einzelnen Gene dabei spielen. Die 72 identifizierten Genregionen seien dafür eine gute Grundlage.