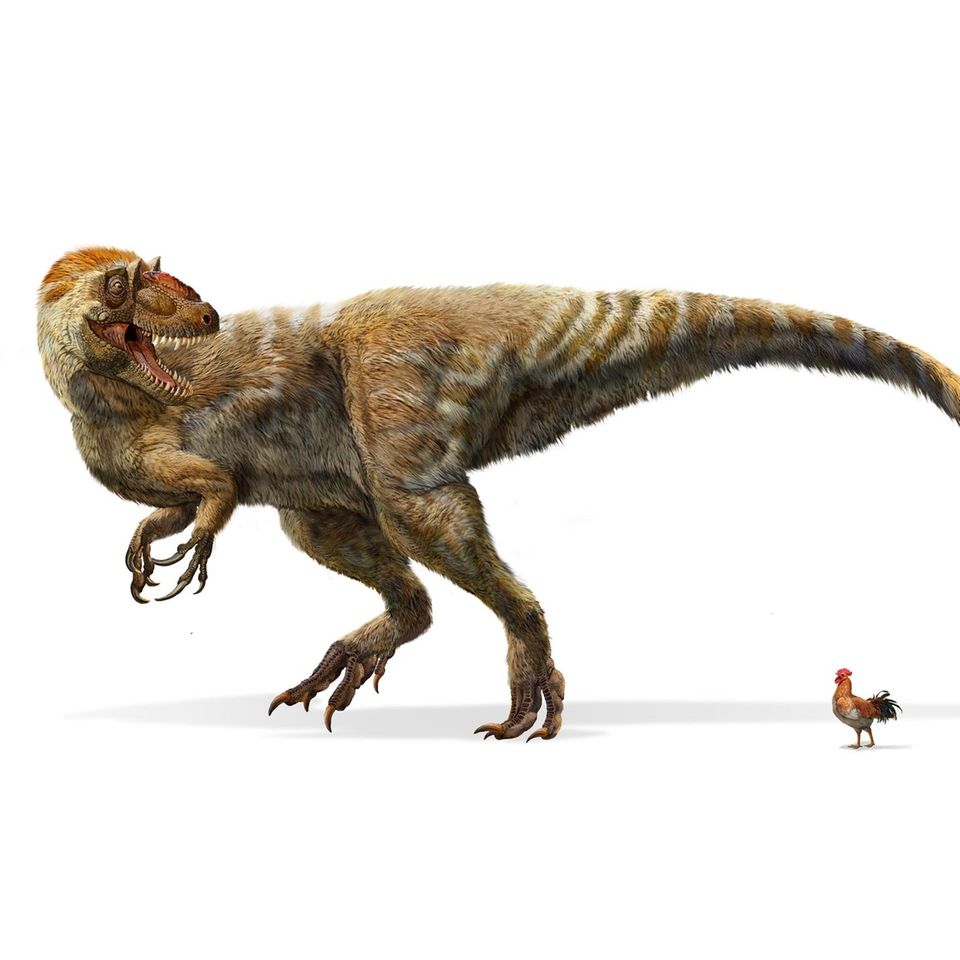Es klingt fast so, als hätten sie sich untereinander abgesprochen und ein gemeinsames Vorgehen beschlossen: Weltweit nutzen Vogelspezies einen sehr ähnlichen Ruf, wenn ein Schmarotzer ihre Nester ansteuert, um dort Eier abzulegen – und die der angehenden Eltern herauszuwerfen. In Australien, Afrika, Asien und Europa gehen 21 Spezies mit einem fast identisch klingenden Warnlaut gegen solche Eindringlinge vor – etwa gegen den Kuckuck.
Wenn der Feind anrückt, durchschneidet ein hoher, beinahe klagender Ton beispielsweise die morgendliche Stille im australischen Buschland. Für menschliche Ohren ein fast harmloser, zarter Laut – doch für die Prachtstaffelschwänze, die hier leben, bedeutet er: Alarm. Irgendwo in der Nähe lauert ein Kuckuck, bereit, sein Ei ins fremde Nest zu schmuggeln. Innerhalb von Sekunden fliegen die kleinen Vögel heran, schimpfen, schlagen mit den Flügeln, jagen den Schmarotzer davon. Berechtigtes "Mobbing" auf Vogel-Art.
Ein gemeinsamer Ruf, obwohl sich die Vögel seit Jahrmillionen getrennt entwickelten
Dieser Sound erklingt auch in afrikanischen Savannen. In den Wäldern Asiens rufen Tienschan-Laubsänger damit zur Verteidigung, in Europa die Grünlaubsänger. Überall bedeutet er: Achtung, Brutparasit! Ein internationales Forschungsteam um Will Feeney von der Estación Biológica de Doñana in Sevilla, Spanien, hat nun dokumentiert, dass 21 Vogelarten auf vier Kontinenten den beinahe identischen alarmierenden Ton verwenden, wenn sie Brutparasiten ausmachen. Bei Letzteren handelt es sich um Vögel, die ihre Eier in Nester legen, um andere für die Aufzucht ihrer Jungen arbeiten zu lassen – eine raffinierte, aber zerstörerische Strategie, die für die unfreiwilligen Ersatzeltern fatale Konsequenzen hat. Sie ziehen fremden Nachwuchs auf. Neben dem Kuckuck verfolgen global rund 100 Arten diese Strategie.
Die Forschenden zeichneten Rufe aus verschiedenen Regionen auf und spielten sie Vögeln auf anderen Kontinenten vor. Das Ergebnis war verblüffend: Selbst Arten, die seit mehr als 50 Millionen Jahren keinen gemeinsamen Vorfahren mehr haben, reagierten auf die fremden Warnungen so, als wären sie ihnen bekannt. Sie flogen herbei, suchten hektisch nach dem Störenfried, manche begannen sofort zu "mobben", also den imaginären Feind durch koordiniertes Anfliegen und Rufen zu vertreiben.

Ein Umstand, der darauf hindeutet, dass der Ruf nicht nur innerhalb einer Spezies verstanden wird – sondern quer über Artgrenzen hinweg. Besonders häufig verwenden Arten ihn in Gebieten, in denen viele verschiedene Brutparasiten vorkommen – also dort, wo sich potenzielle Opfer gegenseitig helfen müssen. Bei kooperativ brütenden Spezies könnte der Laut sogar gezielt als Hilferuf gedacht sein, um Artgenossen zur Verteidigung zu mobilisieren.
Die Vögel benutzen einen uralten emotionalen Laut – ähnlich einem menschlichen Schrei
Wie aber ist es möglich, dass so viele Vogelarten denselben Ruf verwenden – und verstehen? Die Forschenden fanden heraus: Der Laut selber ist allen angeboren, sein gezielter Einsatz wird erlernt. Die Verwendung des Tons muss sich über Generationen verbreitet und durchgesetzt haben – und das artübergreifend. Die Vögel bringen ihn nur im passenden Kontext hervor, also wenn ein Brutparasit auftaucht. Diese "erlernte Nutzung einer angeborenen Klang-Bedeutungs-Verknüpfung", wie die Forschenden es etwas umständlich formulieren, stellt ein Zwischending zwischen angeborenen und erlernten Kommunikationsformen dar – und erscheint als ein Modell dafür, wie Sprache entstehen könnte. Denn: Die Vögel verwenden einen vor langer Zeit entwickelten emotionalen Laut – ähnlich einem menschlichen Schmerzensschrei – und haben ihn für einen neuen Zweck umfunktioniert.
Schon Charles Darwin hatte 1871 in seinem Werk "The Descent of Man" vermutet, dass die Anfänge menschlicher Sprache in der Nachahmung und neuer Verwendung instinktiver Laute liegen könnten – in uns angeborenen Äußerungen wie Schreien, die irgendwann umgemodelt wurden. Bis heute sind Beweise dafür rar, dass solche Übergänge auch in der Tierwelt existieren. Feeneys Studie liefert nun einen Beleg dafür. Heute erschallt der Verteidigungsruf vielerorts auf der Erde, vom australischen Busch über afrikanische Savannen bis in europäische Wälder. Es ist ein Sound, der zugleich uralt und universell ist – und vielleicht ein Beweis dafür, dass Verständigung in der Natur keine rein menschliche Erfindung ist.