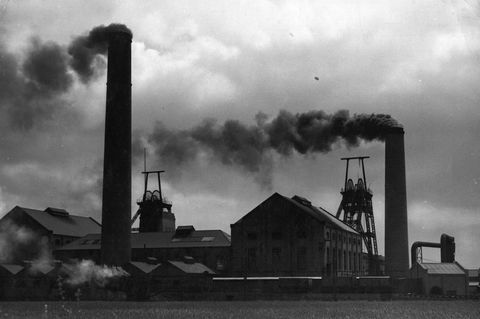So unvorstellbar das scheint: Das Mittelmeer trocknete einst weitgehend aus. Das Meerwasser wurde im Zuge dessen immer salziger, unzählige Tier- und Pflanzenarten starben aus. Lediglich etwa elf Prozent der nur dort vorkommenden Arten überlebten die Krise, berichtet ein Forschungsteam nun im Fachmagazin "Science". Mindestens 1,7 Millionen Jahre habe die Artenvielfalt gebraucht, um sich zu erholen, als wieder Wasser in das gewaltige Becken schoss.
Auch heute noch gibt es nur einen Durchlass vom Atlantik zum Mittelmeer: die Straße von Gibraltar. Die nur wenige Kilometer breite Rinne lässt frisches Wasser aus dem Atlantik ins salzhaltigere Mittelmeer strömen.
Durch Bewegungen im oberen Erdmantel vor etwa sechs Millionen Jahren schloss sich die Passage der heute gängigen Theorie zufolge. Schon ab der Zeit vor etwa 7,6 Millionen Jahren kam es im Zuge der Verengung des Durchgangs zu starken Salzgehalts- und Temperaturschwankungen im Mittelmeer.
Ein Meer trocknet aus
Ohne Zufluss vom Atlantik verdunstete das Wasser im Mittelmeer schließlich weitgehend - der Zufluss aus Strömen wie dem Nil oder dem Ebro war viel zu gering, um das zwischen Afrika, Europa und Vorderasien liegende Becken gefüllt zu halten.
Noch heute zeugt eine kilometerdicke Salzschicht unter dem Meer vom Zustand vor 5,5 Millionen Jahren: Rund eine Million Kubikkilometer Salz sammelte sich an, wie das Team um Konstantina Agiadi von der Universität Wien schreibt.

Um den Einfluss der extremen Veränderungen auf das Leben im Mittelmeer zu ergründen, bezogen die Forschenden 12 bis 3,6 Millionen Jahre alte Fossilien von Fundstellen in den Anrainerstaaten sowie aus Sedimentkernen der Tiefsee in ihre Analyse ein.
Nadelöhr für das Leben
Demnach gab es gut zwei Drittel der Arten im Mittelmeer nach der sogenannten Messinischen Salinitätskrise dort nicht mehr. Tropische riffbildende Korallen starben aus, wie es in der Studie heißt. Von 779 ursprünglich nur im Mittelmeer vorkommenden Arten hätten lediglich 86 überlebt - wie und wo ihnen das gelang, sei bisher unklar.
Nachdem der Atlantik vor etwa 5,33 Millionen Jahren wieder in das Becken strömte, eroberten frühere und zuvor nicht heimische Spezies den Lebensraum. Auch Weiße Haie und Delfine kamen nun ins Mittelmeer.
Insgesamt dauerte die Erholung des Ökosystems überraschend lange, wie das Team um Agiadi schreibt. Das noch heute bestehende Muster einer von Westen nach Osten stetig abnehmenden Artenvielfalt entstand. Heutzutage sei die Artenvielfalt im Verhältnis zur Größe des Beckens wegen der vielen nur im Mittelmeerraum vorkommenden Spezies überproportional hoch.
Lebensfeindliche Salzwüste
In seinem Buch «Urwelten» hat der Paläontologe und Evolutionsbiologe Thomas Halliday beschrieben, wie sich Forscher den Ablauf der Geschehnisse vorstellen. Im Mittelmeergebiet seien Inseln zu Gebirgen geworden, als das Wasser schwand, heißt es darin. Vier Kilometer unter dem Meeresspiegel liegende Täler seien entstanden - das am tiefsten liegende Land der Welt.

Fallwinde seien an den Felswänden herabgestürzt, so Halliday. "Obwohl es sich gerade um einen eher kühlen Zeitabschnitt der Erdgeschichte handelt, kann die maximale Lufttemperatur an einem heißen Sommertag vier Kilometer tief auf dem Grund der Schlucht höllische 80 Grad Celsius erreichen - etwa 25 Grad mehr als die wärmste Temperatur, die in der Neuzeit je im kalifornischen Death Valley gemessen worden ist."
Am Boden des Mittelmeerbeckens habe sich eine stellenweise mehr als drei Kilometer dicke, glänzende Mischung aus Gips und Natriumchlorid abgelagert. Dann sei das Wasser des Atlantik zunächst wieder ins westliche Becken geschossen. Später füllte sich auch der östliche Teil - womöglich über den "gewaltigsten Wasserfall, den die Erde je gesehen hat".
Wasserfall der Superlative?
1.500 Meter sei er Annahmen zufolge hoch gewesen, heißt es im Buch, das Wasser könne dort womöglich mit einer Geschwindigkeit von fast 250 Kilometern pro Stunde über den Steilhang geschossen sein und sich zum großen Teil in Nebel verwandelt haben, bevor es den Grund erreichte.
"Trotz dieser fortgesetzten Sintflut, die das östliche Mittelmeer alle zweieinhalb Stunden um einen Meter hebt, wird es mehr als ein Jahr dauern, bis das östliche Mittelmeer gefüllt ist, bis Malta, Gozo und Sizilien endgültig von Afrika und Italien abgeschnitten sind und Gargano wieder eine Insel wird", heißt es im Buch.
Quellen für Salz
Bewegungen der Erdkruste haben im Laufe der Erdgeschichte immer wieder zur Isolierung regionaler Meeresgebiete von Ozeanen und zu massiven Salzansammlungen geführt, wie die Forschenden um Agiadi erläutern. Tausende Kubikkilometer umfassende Salzablagerungen - Salzriesen genannt - seien auch in Australien, Sibirien, dem Mittleren Osten und anderswo gefunden worden.
Seit der Antike bis heute würden sie zur Salzgewinnung genutzt, etwa im Bergwerk Hallstatt in Österreich und im Salzbergwerk Khewra in Pakistan.