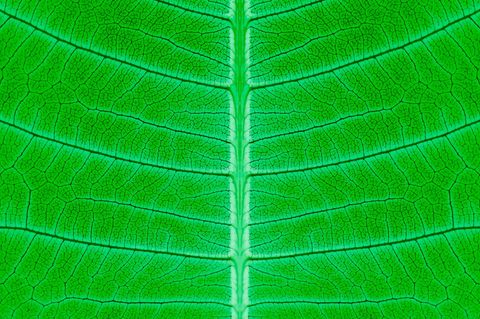Eisen aus Industrieabgasen verändert einer Studie zufolge das Ökosystem im Nordpazifik. Das Metall gelange über die Atmosphäre zu entlegenen Ozeanregionen und werde dort durch Regen ins Meer gespült. "Das ist ein Beispiel dafür, wie weitreichend menschliche Verschmutzung marine Ökosysteme beeinflussen kann – selbst tausende Kilometer vom Ursprungsort entfernt", sagte Studienleiter Nick Hawco von der Universität von Hawaii.
Das Eisen wirkt nach Forscherangaben im Meer als Dünger und löst eine starke Vermehrung von Mikroalgen und anderem Phytoplankton aus - mit negativen Folgen. Publiziert wurden die Ergebnisse in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften.
Wie Industrieabgase das Meer beeinflussen
Untersucht wurde eine Region nördlich von Hawaii, die in Windrichtung großer Industriezentren Ostasiens liegt. Dass industrielles Eisen dieses Gebiet im Nordpazifik erreicht, war bereits bekannt, doch die genauen Auswirkungen auf das Ökosystem dieser für die Fischerei bedeutenden Region waren bislang unklar.
In vier Expeditionen untersuchte das Team Wasserproben, Phytoplankton und die Ozeandynamik. Die Ergebnisse zeigen: Im Frühjahr hat das Phytoplankton in der untersuchten Region Eisenmangel, sodass zusätzliches Eisen sein typisches Frühjahrswachstum ankurbelt. In der Folge des starken Phytoplankton-Wachstums werden andere Nährstoffe schneller verbraucht – was später in der Saison zu einem Rückgang der Population führe.
Dieser Effekt stimmt laut Studie mit Satellitenmessungen überein: "Diese zeigen eine kürzere, aber intensivere Frühjahrsblüte, gefolgt von einem früheren Eintreten nährstoffarmer Bedingungen im Sommer."
Eisen aus der Industrie hat einen großen Anteil im Meer
Das Forschungsteam untersuchte die sogenannte Nordpazifische Übergangszone nördlich von Hawaii. Hier treffen nährstoffarme Ökosysteme auf weiter nördlich liegende nährstoffreiche. "Mit dem zusätzlichen Eisen verschiebt sich diese Grenze nach Norden – ein Trend, der sich durch die Ozeanerwärmung noch verstärkt", erklärt Hawco. Leider gehörten die Regionen, die näher an Hawaii liegen, zu den Verlierern.
"Da Phytoplankton die Grundlage der marinen Nahrungsketten bildet, können wir uns vorstellen, dass eine kürzere Wachstumsperiode Auswirkungen auf die Biomasse von Fischen und anderen Tieren haben könnte", berichtet Hawco. Belegt sei ein solcher Zusammenhang zwischen dem anthropogenen Eiseneintrag und Beobachtungen von Meeressäugern oder der Fischerei bislang jedoch nicht.
Das Team hatte die Isotopenzusammensetzung des Eisens analysiert, um zwischen natürlichen und industriellen Quellen zu unterscheiden. Isotope sind verschieden schwere Atomsorten eines Elements. Der geschätzte industrielle Eiseneintrag ist beachtlich. Demnach stammt die Eisenmenge des Oberflächenwassers zu rund 40 Prozent aus der Industrie.