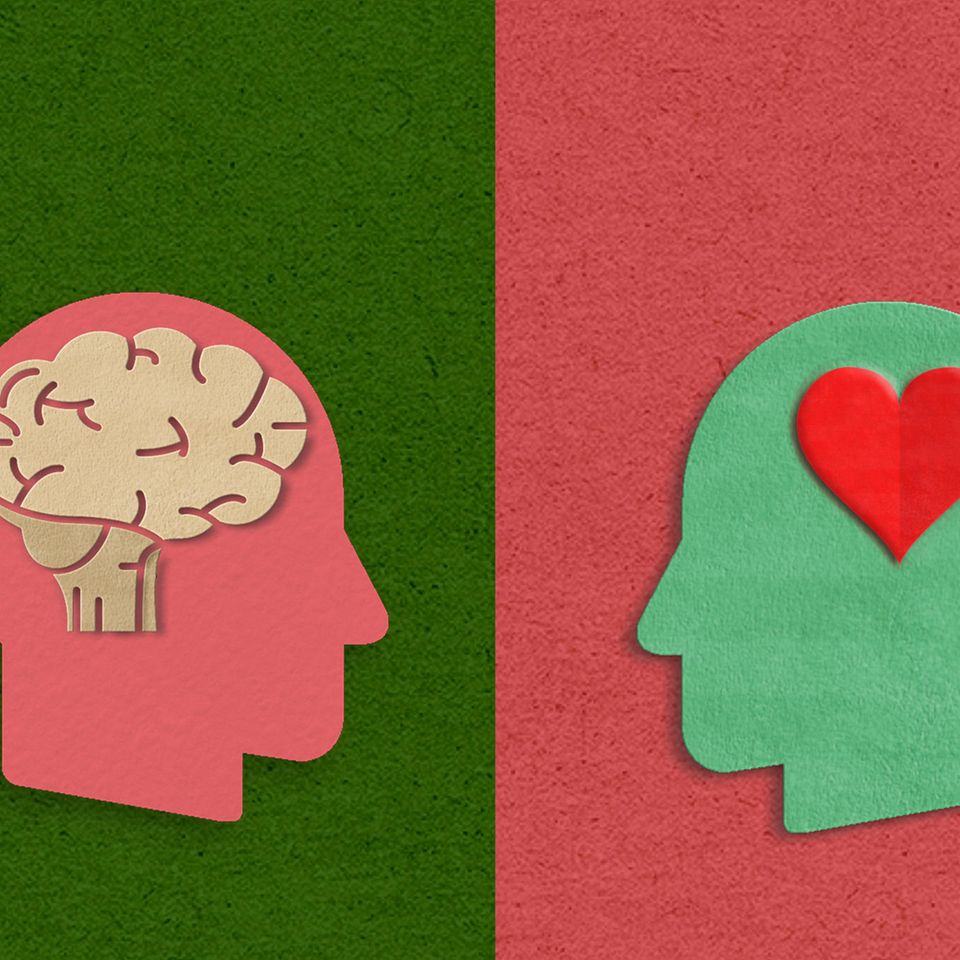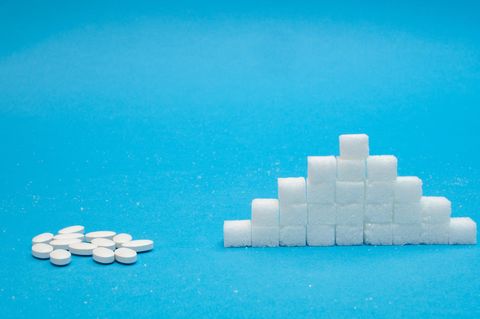Wer sich eine Erkältung oder andere Infektion zuzieht, fühlt sich oft extrem matt und möchte sich am liebsten hinlegen. Dieses Phänomen wird im Englischen fachsprachlich "sickness behaviour" ("Krankheitsverhalten") genannt. Als Auslöser gelten körpereigene Entzündungsbotenstoffe (Zytokine), die das Nervensystem beeinflussen. Sie sorgen dafür, dass wir uns schonen, vermutlich, damit unser Körper alle Ressourcen in die Heilung stecken kann.
In einer Studie der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Duisburg-Essen, die in der Fachzeitschrift "Brain, Behavior, and Immunity" erschienen ist, haben Forschende diesen Effekt nun näher untersucht. Sie stellten fest, dass Infektionen uns offenbar nicht nur schlapp werden lassen, sondern auch empathieloser gegenüber den Gefühlen unserer Mitmenschen.
Den Frauen wurden entzündungsfördernde Stoffe verabreicht
Für ihr Experiment injizierten die Forschenden 52 weiblichen Probandinnen zur Hälfte ein niedrig dosiertes bakterielles Endotoxin namens LPS. Es stammt aus der Zellhülle von Bakterien und provoziert wie bei einer echten Infektion eine Entzündungsreaktion. Die andere Hälfte bekam ein Placebo.
Nach zwei Stunden wurden die Probandinnen einem Test namens "Social Interaction Empathy Task" unterzogen, der das Empathievermögen speziell von Frauen misst. Dazu wurden den Probandinnen Bilder von Frauen gezeigt, die körperliches oder psychisches Leid erfuhren. Auf anderen Bildern, die als Kontrolle dienten, waren neutrale Interaktionen mit Männern zu sehen. Die Probandinnen wurden gebeten, den Schmerz der abgebildeten Personen jeweils auf einer Skala zu bewerten.
Die Empathie für seelischen Schmerz lässt plötzlich nach
"Die Ergebnisse haben uns überrascht", sagt Erstautorin Vera Flasbeck vom LWL-Universitätsklinikum Bochum in einer Pressemitteilung: "Während das Mitgefühl für körperlichen Schmerz bei der LPS- und der Placebo-Gruppe weitgehend gleich war, zeigte sich hingegen für psychischen Schmerz bei den Probandinnen unter LPS-Einwirkung eine signifikant verringerte Empathie."
Doch warum werden wir überhaupt grummelig, wenn wir uns krank fühlen? "Wir vermuten, dass die verringerte Empathie dazu dient, im Krankheitsfall Energie im Hinblick auf soziales Engagement zu sparen", sagt Ko-Autor Prof. Dr. Martin Brüne vom LWL-Universitätsklinikum Bochum.
Krankheitsverhalten könnte soziale Folgen haben
Die Autorinnen und Autoren halten ihre Ergebnisse auch gesellschaftspolitisch für relevant. Vor allem in Hinblick auf die vergangene Corona-Pandemie. Möglicherweise könne sich ein allgemeines Krankheitsgefühl auf die poltische Entscheidungsfindung auswirken.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, wie das soziale Umfeld auf die Kranken reagiert. Ob etwa Krankheit zu sozialer Isolation oder Konflikten führt. Frühere Studien zeichneten hierzu ein zwiespältiges Bild, schreiben die Studienautor*innen: Die einen meiden die Kranken, andere hingegen kümmern sich fürsorglich um sie.
Männer wurden in der Studie nicht berücksichtigt
Denkbar wäre, dass Kranke auf Nahestehende, die sie versorgen, weniger unempathisch und abweisend reagieren als auf fremde Menschen, die sie auf Bildern sehen. Dies wurde in der vorliegenden Studie allerdings nicht untersucht.
Außerdem wurden Männer in der Studie außen vor gelassen. Da bei ihnen ähnliche Entzündungsmechanismen wirken, wäre es zumindest möglich, dass der Effekt auch bei ihnen auftritt.