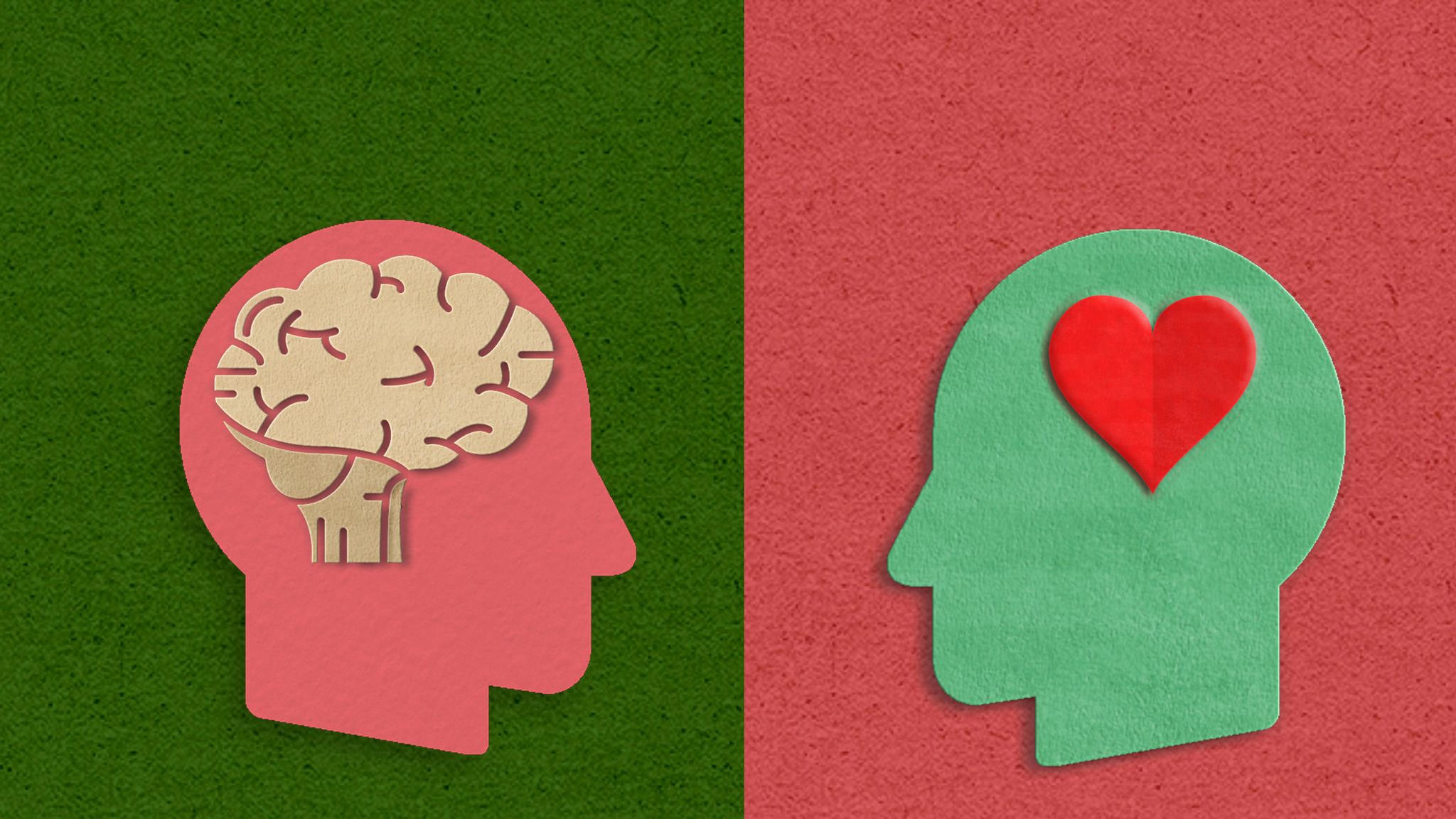Wohl keine Fähigkeit prägt das menschliche Miteinander so sehr wie unser Einfühlungsvermögen – die Empathie. Sie schließt die Kluft zwischen dem Ich und den anderen. Denn ohne sie würden wir nur unsere eigenen Empfindungen spüren, wären kaum in der Lage, emotionale Beziehungen aufzubauen – und lebten gewissermaßen in innerer Isolation.
Erst unser Einfühlungsvermögen versetzt uns in die Lage, das Gemüt eines Gegenübers zu erfassen, den Schmerz nachzuempfinden, den ein trauernder Freund erlebt, uns mit jemandem zu ärgern, der wütend auf seinen Vorgesetzten ist. Mit anderen Worten: Empathie ist der Schlüssel zu fremden Gefühlswelten. Erst sie erlaubt es uns, die Bedürfnisse unserer Mitmenschen zu erkennen und auf sie einzugehen.
So fundamental ist diese Gabe, dass Evolutionsbiologen in ihr ein Erbe der Urgeschichte sehen. Sie gehen davon aus, dass sich Empathie (in ersten Formen) schon vor Jahrmillionen entwickelt hat – und dementsprechend fest in unseren Genen verankert ist. In welchem Maß wir imstande sind, empathisch zu reagieren, scheint uns allerdings nicht allein in die Wiege gelegt zu sein. Neuere Forschungen deuten vielmehr darauf hin, dass die Fähigkeit sich zeitlebens mehr oder weniger stark entfaltet – und damit flexibler ist als lange gedacht. Welche Faktoren aber beeinflussen unser Vermögen, mitzufühlen? Und können wir selbst in höherem Alter noch lernen, empathischer zu sein?