Sie trotzen erfolgreicher Krankheiten, überstehen eher Hungersnöte, fallen selbst Kriegen und Epidemien weniger häufig zum Opfer: In fast allen Kulturen leben Frauen länger als Männer. Im Schnitt sind es weltweit rund fünf Jahre. Medizinischer Fortschritt, bessere Ernährung, weniger körperlich schwere Arbeit – all das hat die Lebenserwartung beider Geschlechter steigen lassen. Doch der Abstand zwischen ihnen bleibt bestehen.
Eine neue Studie unter Leitung des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig liefert nun eine verblüffende Erklärung: Demnach hat das Gefälle tiefe evolutionäre Wurzeln und findet sich in ähnlicher Form auch bei anderen Säugetieren wieder.
Ein Muster zieht sich durch das Tierreich
Für ihre Analyse haben die Forschenden Lebensdaten aus Zoos auf der ganzen Welt ausgewertet, die bislang umfassendste Datensammlung ihrer Art. Mehr als 1.100 Tierarten, von Pavianen über Fledermäuse bis zu Pinguinen, wurden erfasst. Das Ergebnis ist eindeutig: Bei rund drei Viertel aller Säugetiere leben die Weibchen länger als die Männchen, im Schnitt etwa zwölf Prozent.
Doch bei den Vögeln kehrt sich das Muster um – dort überleben die Männchen ihre Partnerinnen im Mittel um rund fünf Prozent. Offenbar steckt dahinter kein Zufall, sondern ein biologisches Prinzip. Und zwar eines, das sich quer durch das Tierreich zieht.
Die doppelte Chance der Weibchen
Ein Teil der Erklärung liegt in den Geschlechtschromosomen. Bei Säugetieren haben Weibchen zwei X-Chromosomen, Männchen hingegen ein X und ein Y. Fällt auf einem der X-Chromosomen eine schädliche Mutation an, kann das zweite X sie meist ausgleichen. Männchen dagegen besitzen kein "Backup", Defekte schlagen bei ihnen stärker durch.
Bei Vögeln ist es umgekehrt: Dort tragen die Weibchen zwei verschiedene Geschlechtschromosomen (Z und W), die Männchen dagegen zwei identische (ZZ). Entsprechend genießen die Männchen einen gewissen genetischen Schutz und leben im statistischen Mittel länger.
Doch so elegant diese Erklärung klingt: Sie reicht nicht aus. Denn es gibt unzählige Ausnahmen. Raubvögel etwa – Falken, Bussarde, Adler – sind ein Gegenbeispiel: Ihre Weibchen sind nicht nur größer, sondern auch langlebiger. Die Chromosomen-Hypothese kann das biologische Rätsel also nur teilweise auflösen.
Der hohe Preis der Konkurrenz
Den entscheidenden Hinweis liefert ein anderer Faktor: sexuelle Selektion – also der Wettbewerb um Fortpflanzung. Bei Arten, in denen Männchen um Partnerinnen kämpfen, zahlt das stärkere Geschlecht einen hohen biologischen Preis. Je ausgeprägter der Konkurrenzdruck, desto früher sterben die Männchen. Wer ständig imponiert, riskiert mehr. Sexuelle Selektion wirke wie ein evolutionäres Wettrüsten, betont das Forschungsteam in ihrer Publikation. Sie belohne Stärke und Risikobereitschaft, aber nicht unbedingt Langlebigkeit.
Bei Arten mit friedlicheren Paarungsverhältnissen – etwa monogamen Vogelarten, die gemeinsam brüten und ihre Jungen großziehen – gleichen sich die Lebensspannen der Geschlechter an oder kehren sich sogar um. Dort leben oft die Männchen länger, weil sie weniger Energie in Konkurrenz und Kampf investieren müssen.
Das archaische Erbe bleibt
Ein weiteres Muster entdeckten die Forschenden in der Fürsorge. Bei Arten, in denen ein Geschlecht die Hauptlast der Aufzucht trägt – etwa bei vielen Säugetierweibchen –, verlängert sich dessen Leben messbar. Evolutionär ergibt das Sinn: Wer sich um Nachkommen kümmert, muss lange genug überleben, um sie großzuziehen. Man könnte also sagen: Die Natur belohnt Fürsorge mit Lebenszeit.
Vergleicht man Menschen mit ihren nächsten Verwandten, bestätigt sich der Trend: Auch Schimpansen- und Gorillaweibchen leben länger als ihre Männchen. Beim Menschen ist der Abstand zwar geringer, doch das Muster bleibt.
Die Forschenden vermuten, dass die schwächere geschlechtsspezifische Selektion beim Menschen – also geringerer Konkurrenzdruck und größere soziale Ausgeglichenheit zwischen den Geschlechtern – den Abstand etwas verringert hat. Zugleich zeigen historische Daten aus Schweden und Japan: Die Kluft wächst, wenn Gefahren für Mütter, etwa bei der Geburt, abnehmen.
Mit anderen Worten: Die moderne Medizin kann Unterschiede mildern, aber nicht auslöschen. Der evolutionäre Rucksack bleibt. Ein Erbe aus Zeiten, in denen Fortpflanzung gefährlicher war als das Altern, und in denen der Kampf um Partnerinnen wichtiger war als das eigene Überleben.
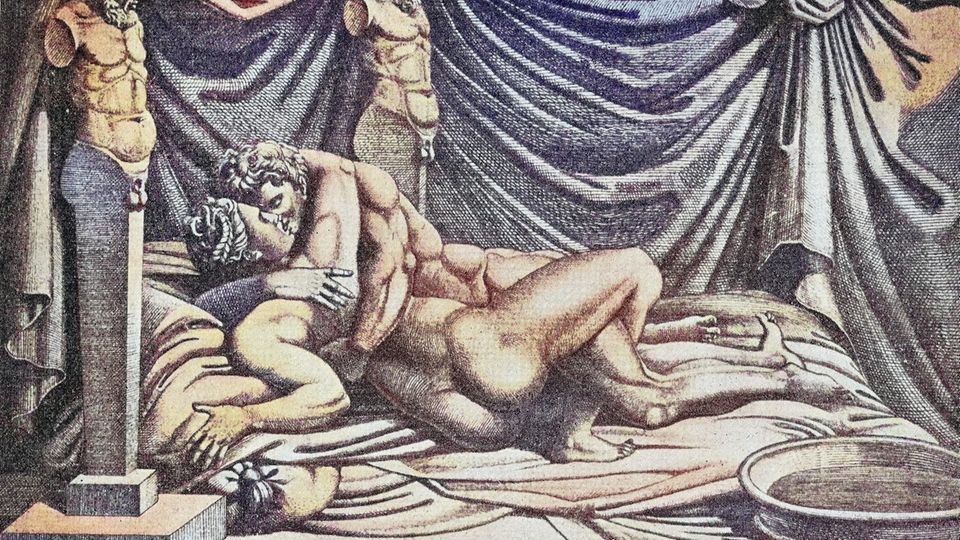
Wer sich kümmert, lebt länger
Heute hat sich die Bühne geändert, doch das alte Paradigma wirkt fort. Männer gehen größere Risiken ein: Sie fahren häufiger zu schnell, greifen öfter zu Alkohol oder Drogen, und sie sterben häufiger durch Unfälle, Suizide oder Herzkrankheiten. Viele dieser Risiken sind sozial und kulturell geprägt, doch sie fügen sich erstaunlich gut in das evolutionäre Prinzip, das die Forschenden sichtbar gemacht haben: Wettbewerb und Risikobereitschaft zahlen sich kurzfristig aus, langfristig aber kosten sie Leben.
Umgekehrt scheint Fürsorge die Lebensspanne zu verlängern. Väter, die sich um ihre Kinder kümmern, leben statistisch länger – vielleicht, weil Verantwortung den Blick auf das eigene Leben verändert. So spiegelt sich in modernen Lebensweisen, was die Natur schon seit Jahrmillionen zeigt: Wer auf Erhalt statt auf Wettkampf setzt, wer schützt statt kämpft, gewinnt wertvolle Zeit.



























