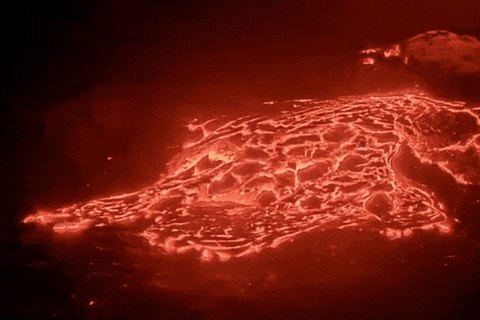GEO: Da bricht ein Vulkan aus, die Menschen aus der Umgebung versuchen, ihr Hab und Gut zu retten – und Sie fahren möglichst heran an den Krater und Lavastrom. Klingt verwegen.
Carsten Peter: Mag sein, aber da gibt es eine Faszination in mir. Nachdem ich diesen Kräften der Natur, der Hitze und den unglaublichen Energien einmal ausgesetzt war, kann ich nicht mehr davon lassen. Zumal jeder Ausbruch anders ist. Es ist, als lerne man einen neuen Menschen kennen, der einen total begeistert – und man möchte immer mehr über sie oder ihn wissen.
Was ist immer neu bei Ausbrüchen?
Jeder Vulkan hat seinen eigenen Charakter, ob der Feuerberg in der Gebirgskette Cumbre Vieja auf La Palma, der Soufrière Hills auf der Karibikinsel Montserrat oder der Ätna auf Sizilien. Das betrifft seine Form ebenso wie die Zusammensetzung der Lava. Und es betrifft auch die Gefahr. Manche Vulkane sind sehr explosiv, bei anderen ist das Risiko kalkulierbarer.
Oft sind Sie allein unterwegs – ganz anders als vor einigen Jahren am Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo. Damals bestand die Expedition aus mehr als 100 Personen ...
Dort wollten Forscherinnen und Forscher den größten Lavasee der Erde wissenschaftlich erkunden, und mein Freund und Kletterpartner Chris Heinlein und ich begleiteten sie. Das war eine Herausforderung, auch logistisch. Wir mussten uns über mehrere Terrassen mehr als 300 Meter tief abseilen, was technisch schwierig war. Der Lavasee war zu der Zeit recht konstant aktiv. Wir haben verschiedene Messgeräte nach unten gebracht. Der Nyiragongo ist einer der gefährlichsten Vulkane überhaupt, weil er nahe der Zweimillionenstadt Goma liegt, und zugleich ist er besonders schlecht überwacht.
Was macht diesen Vulkan so gefährlich?
Die Gefährlichkeit definiert sich vor allem darüber, wie sehr besiedeltes Gebiet von einem Ausbruch betroffen wäre. Im Mai 2021 ist der Lavastrom nach einer Eruption erst kurz vor Goma zum Stillstand gekommen. Viele Menschen sind damals geflohen. 2002 waren Teile der Metropole bei einem anderen Ausbruch des Nyiragongo verwüstet worden.
Wie war es, als Sie abgestiegen sind?
Der Nyiragongo ist knapp 3500 Meter hoch, und die Temperaturen sinken nachts bis unter den Gefrierpunkt. Wenn man aber in den Krater einsteigt, wird es kontinuierlich wärmer. Wir hatten feuchtes Wetter, was die Expedition sehr erschwert hat. Wir sind auf die zweite Terrasse abgestiegen, haben dort Messungen vorgenommen – und dann begann der Nieselregen. Das heißt: Es regnete Schwefelsäure, und die greift die Schleimhäute an. Es war eine sehr unangenehme Situation, zumal wir durch den Nebel kaum etwas sehen konnten. Die Wissenschaftler hatten eigentlich eine Woche im Krater bleiben wollen, doch das war ihnen unter diesen Bedingungen zu viel. Nach nur einem Tag haben sie abgebrochen.
Was haben Sie gemacht? Allein konnten Sie die Expedition kaum fortsetzen.
Ich stand vor einem Problem. Eine solche Expedition vorzubereiten, ist sehr, sehr aufwendig, und wir waren noch nicht mal ganz unten gewesen. Dann ist auch noch mein Expeditionspartner Chris krank geworden und wollte ebenfalls raus aus dem Krater. Ich bin allein zurückgeblieben, habe abgewartet und am nächsten Tag per Funk versucht zu erfahren, ob sich die Expedition noch retten ließ. Zum Glück ging es Chris besser. Er ist wieder abgestiegen und wir haben uns gemeinsam auf die dritte Terrasse, also nach ganz unten, abgeseilt. Das hat die Forscher und das weitere Team motiviert, ihre Mission fortzusetzen.
Wie war die Atmosphäre dort unten?
Einfach unglaublich. Wir standen an einem gigantischen Feuersee – wobei die Oberfläche des Lavasees sich in Wirklichkeit zehn oder 15 Meter über uns befand. Dämme umgaben ihn wie ein Deich. Es bestand jederzeit die Gefahr, dass sie brechen könnten und die Terrasse mit Lava überflutet würde. Ich bezweifle, dass wir rechtzeitig entkommen wären. Besonders im Zwielicht der Nacht strahlte der See ein magisches rotes Licht ab, und wenn aufsteigende Gasblasen zerplatzten, rissen sie Lavafetzen nach oben. Die konnte ich aber erst sehen, als ich im Schutzanzug kurz auf den Damm geklettert bin, um mir ein Bild zu machen. Die Hitze war kaum auszuhalten, und sie flirrte so sehr, dass ich kaum etwas scharf sah. Es ist eine der heißesten Laven der Erde, 1300 Grad wurden dort schon gemessen.
Was haben Sie gehört?
In der Tiefe gab es ein unheimliches Brummen. Ich weiß nicht, ob ich es hörte oder spürte, so tief waren die Frequenzen. Ein geheimnisvoller Infrasound. Ich wusste erst nicht, ob ich es mir einbildete, doch Chris nahm es auch wahr. Es kam uns vor, als seien wir zu nah am Basslautsprecher in der Diskothek. Es war sehr eigenartig. Das Gefühl: Was ist denn jetzt? Ein Warnzeichen? Sollten wir lieber verschwinden?
Es lässt einen schon schaudern, wenn man den Vulkansee von weit oben sieht. Wie das Loch zur Hölle. Und Sie haben gewagt, ausgerechnet dort unten zu zelten?
Ja, auf der zweiten Terrasse. Es war in der Tat unheimlich. Gasschwaden machten es schwer, mich zu orientieren.
Feuerspuckende Berge, perfekt inszeniert

Feuerspuckende Berge, perfekt inszeniert
Was war größer: das Gefühl der Bedrohung oder die Faszination?
Das ist eine schwierige Frage. Beides hält sich die Waage, wobei die Faszination die treibende Kraft ist. Man darf die Bedrohung aber nie aus den Augen verlieren. Selbst bei größter Erfahrung kann man sich immer noch verschätzen. Es sind schon bekannte Vulkanologen umgekommen bei ihrer Arbeit, wie Katia und Maurice Krafft 1991 beim Ausbruch des Unzen in Japan. Gerade bei den grauen, den explosiven Vulkanen ist es sehr schwer zu prognostizieren, wie sie sich verhalten werden. Ich habe selbst gesehen, wie pyroklastische Lawinen sich von der Topographie lösten und aus Canyons ausbrachen. Wenn man dort hineingerät, hat man keine Chance.
Sie waren 2001 auch auf dem Ätna, als der ausbrach. Was ist dort passiert?
Das war eine unglaubliche Eruption und für mich ein großer Glücksfall. Chris Heinlein und ich hatten etwa drei Tage in der Gipfelregion auf einen Paroxysmus, also einen heftigen explosiven Ausbruch, gewartet, und nichts war passiert. Dann kam die letzte Nacht, und nach Mitternacht kam diese Eruption wirklich. Danach gingen wir schlafen – und als wir in der Früh aufwachten, sahen wir, wie sich direkt vor uns die Spalten öffneten und wahnsinnig schöne Lavafontänen rausschossen. Das war ein sensationelles Erlebnis. Der Ausbruch breitete sich schließlich über den ganzen Berg aus. Es sind immer zunehmend Spalten aufgerissen, und das hat sich immer weiter nach unten fortgesetzt. Das von Anfang an mitzubekommen, war ein unglaubliches Geschenk.
Aber sehr gefährlich.
Schon. Wir wussten ja gar nicht, wie sich der Ausbruch entwickeln würde. Bereits der Beginn war alles andere als harmlos. Eine Spalte war in nächster Nähe eines alten Observatoriums, das bei früheren Eruptionen zerstört worden war. Dort übernachteten wir in einer Art Bunker, der nur ein einziges kleines Fenster hatte. Für uns war das ein idealer Schutzraum, gerade bei den Erdbeben, die uns immer im Schlafsack hin und her schüttelten. Wie ich dann am Morgen nach draußen schaute und realisierte, wie knapp die Lavafontänen vor uns standen, war ich wie vor den Kopf gestoßen. Wenn die Gesteinsmasse in unsere Richtung geflossen wäre und die Öffnung versiegelt hätte, wäre der Bunker zu unserem Grab geworden. Es war knapp für uns, und so etwas kann sehr schnell gehen.
Gab es bei Ihnen noch weitere Male das Gefühl: Das war wirklich knapp?
Den Ausbruch des Soufrière Hills 1995 auf Montserrat fand ich ziemlich extrem. Ich habe Abgänge von pyroklastischen Lawinen fotografiert. Das war spannend, aber ich habe es schon mit der Angst bekommen. Ich wartete darauf, dass ein Teil des Lavadoms kollabieren würde, und man weiß nie, wie heftig so etwas ausfällt. Letztlich kann ich nur von Glück reden, dass ich den Einsturz nicht mitbekommen habe, denn kurz zuvor musste ich abreisen. Ich hätte keine Chance gehabt.
Der Vulkanausbruch machte Teile der Insel unbewohnbar...
Ich bin drei Monate später noch mal hingeflogen und habe mir die Folgen angeschaut. Es war wahnsinnig, wie die Landschaft durch den partiellen Kollaps des Vulkans verändert worden war. Der kleine Ort Harris hatte schon einen Hurrikan durchstanden, und man hatte die Häuser in Stahlbeton wieder aufgebaut. Mittlerweile waren alle Bewohner evakuiert worden. Selbst die Hauptstadt Plymouth war menschenleer und ziemlich vom Vulkan in Mitleidenschaft gezogen. Aus gutem Grund gab es eine Exclusion Zone mit absolutem Betretungsverbot. Da war kein Mensch mehr, es gab nur noch ein paar Kühe und herumirrende Haustiere. In der Umgebung war vor dem Ausbruch eine Art Regenwald gewesen, mit Bäumen und dichter Vegetation. Durch den teilweisen Einbruch des Kraters war alles verschwunden. Man sah keine Bäume mehr, selbst der Humus war weg. Montserrat wurde zu zwei Dritteln unbewohnbar gemacht.
Ist es nicht erstaunlich, dass die Menschen überhaupt dort siedeln, wo es so gefährlich ist?
Sicher, und das trifft zum Beispiel auch für La Palma zu. Nicht weit von dort, wo jüngst der Vulkan ausbrach, hatte es 1949 einen großen Ausbruch gegeben, und etwas weiter im Jahr im Jahr 1712. Es ist nur eine zeitliche Parallelverschiebung. War es eine Fehlplanung, dort zu siedeln? Ich weiß es nicht. Man könnte mit einigem Recht auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs gering ist. Ein Vulkan bietet zudem viele Vorteile. Die Böden sind sehr fruchtbar, die Erträge ganz hervorragend. Solange der Feuerberg sich nicht meldet, ist es in seiner Umgebung wirklich sehr angenehm.
Sie sprechen von Vulkanen fast wie von lebendigen Wesen ...
Für mich sind sie das. Sie sind lebendige Berge. Sie lassen einen die Erdgeschichte erfahren und spüren. Normalerweise sind geologische Prozesse unglaublich langsam, die Hebungen und Verwerfungen, die Entstehung von Sedimentschichten, die Bildung von Tropfsteinhöhlen. Wir können die Konsequenzen dieser Prozesse sehen, aber nicht verfolgen, wie sie entstehen. Und dann gibt es die Vulkane. Wie jetzt durch den Ausbruch auf La Palma innerhalb kürzester Zeit ein neuer Berg entsteht – wo sonst kann man das erleben? In größerem Stil betrachtet: Ich finde es ausgesprochen faszinierend, zu sehen, wie der Vulkanismus unseren Planeten an vielen Orten immer wieder neu modelliert.
Das vollständige Interview lesen Sie im Begleitbuch "Vulkane. Die phantastische Welt der Feuerberge" (herausgegeben von GEO-Redakteur Siebo Heinken, 272 S., ca. 214 farbige Abbildungen, 40 Euro) zur großen Ausstellung "Vulkane", zu sehen vom 10. März bis 10. Dezember 2023 im Lokschuppen Rosenheim. In der Ausstellung werden neben einer Fülle von Installationen und Objekten auch viele weitere Fotos von Carsten Peter gezeigt.