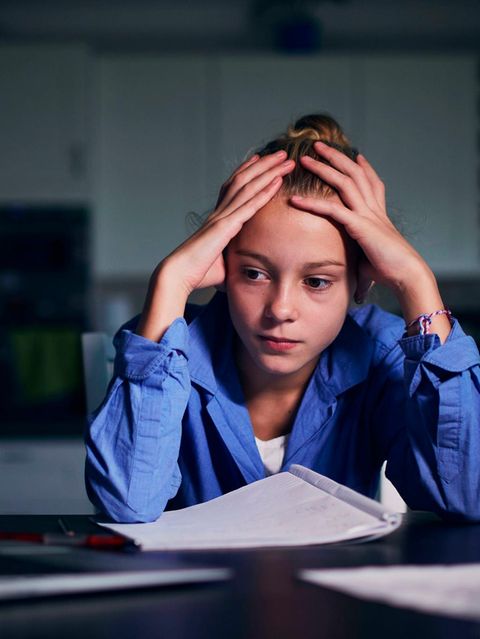Ein Taktwechsel, ein unerwarteter Akkord oder ein Übergang von Dur zu Moll: Solche Elemente verleihen Kompositionen Spannung, weil sie mit unseren Erwartungen brechen. Hören wir Musik, sagt unser Gehirn unentwegt voraus, wie Rhythmus und Melodie mit höchster Wahrscheinlichkeit fortgeführt werden. Erfüllen sich die Erwartungen nicht, lässt sich in unseren Hirnwellen ein Moment der Überraschung messen: Hier wurde ein Ausreißer identifiziert!
Ein solches musikalisches Gespür ist keine kulturelle Eigenart. Menschen auf der ganzen Welt besitzen es. Offen ist jedoch, zu welchen Teilen es angeboren respektive erlernt ist. Untersuchungen mit Babys, ja sogar mit Ungeborenen liefern erste Hinweise. Ab der 35. Schwangerschaftswoche reagieren Föten mit Bewegungen und einer veränderten Herzfrequenz auf Musik. Neugeborene sind in der Lage, einen Takt wahrzunehmen und Tonintervalle zu unterscheiden.
Forschende hoffen, durch solche Untersuchungen Grundlegendes über unsere kognitive Entwicklung herauszufinden. Um Sprache zu verstehen, müssen Kinder beispielsweise lernen, Geräusche aus dem Umgebungslärm herauszufiltern, statistische Muster darin zu erkennen und sie zu interpretieren – Fähigkeiten, die auch unserem Gefühl für Rhythmus und Melodien zugrunde liegen.
Klassische Musik statt stumpfer Tonfolgen
Ein Team um Roberta Bianco vom Italian Institute of Technology ging dem Ursprung des musikalischen Gespürs in einer aktuellen Studie auf den Grund. Ziel war, herauszufinden, ob Babys Erwartungen an Rhythmus und Melodie entwickeln, so wie Erwachsene es tun – und zwar unter realistischen Bedingungen. In bisherigen Versuchen spielten Forschende Säuglingen meist gleichförmige Takt- und Tonfolgen vor, in denen sich seltene Ausreißer verbargen. Dabei fehle "die große Bandbreite an Überraschungen, die echte Musik von Note zu Note bereithalten kann", schreiben Bianco und ihre Kolleginnen in der Fachzeitschrift "PLOS Biology".
Für ihre Studie bedienten sich die Forschenden der Werke eines alten Meisters. Sie spielten 49 Neugeborenen zehn Klavierkompositionen von Johann Sebastian Bach vor. Dabei maßen sie deren Hirnwellen über Elektroden auf der Kopfhaut. Die Babys schliefen während der Prozedur; eine übliche Vorgehensweise bei so kleinen Kindern.
Die Neugeborenen hörten Bachs Werke entweder im Original oder in einer zerstückelten und durcheinander gewürfelten Version. Messungen zeigten, dass die Kleinen nicht auf Überraschungsmomente in der Melodie reagierten – die Fähigkeit, ihr zu folgen und ihren Verlauf vorherzusagen, entwickelt sich offenbar erst später. Rhythmusänderungen hingegen spiegelten sich sehr wohl in der Hirnaktivität wieder: Die neuronalen Schaltkreise der Babys reagierten, wenn ihre Erwartungen nicht eintrafen.
Dabei war die Reaktion ausgeprägter, wenn die Kinder den Originalstücken lauschten. Bei den durcheinander gewürfelten Versionen fehlten Regelmäßigkeiten, die ihrem Gehirn eine Vorhersage ermöglicht hätten. Die Forschenden resümieren: "Selbst unsere kleinsten, gerade einmal zwei Tage alten Zuhörer können rhythmische Muster vorwegnehmen, was zeigt, dass einige Schlüsselelemente der musikalischen Wahrnehmung von Geburt an verankert sind." Das Team geht davon aus, dass den Fähigkeiten ihrer kleinen Testpersonen keine musikalische Früherziehung im Mutterleib zugrunde liegt, sondern dass das menschliche Gehirn die statistische Grundausstattung besitzt, um musikalische Muster schnell zu lernen.
Noch zu klären ist, ob schlafende Babys Musik anders wahrnehmen als wache Babys. Womöglich, so schreiben die Forschenden, konzentriert sich das schlummernde Gehirn bei der Verarbeitung akustischer Reize auf das Nötigste – und gibt Rhythmen Vorrang vor Melodien. "Dieser Hypothese zufolge wird das Timing gegenüber der Tonhöhe bevorzugt, da es auffälliger ist und möglicherweise mit überlebensrelevanten Signalen in Verbindung steht."
Interessanterweise ist das Rhythmusgefühl keine Eigenart des Menschen. Seine evolutionären Wurzeln reichen tiefer. Auch Schimpansen, Makaken und Rhesusaffen scheinen es zu besitzen. "Rhythmus mag Teil unseres biologischen Werkzeugkastens sein, während wir uns ein Gefühl für Melodien erst aneignen müssen", schreiben die Forschenden.