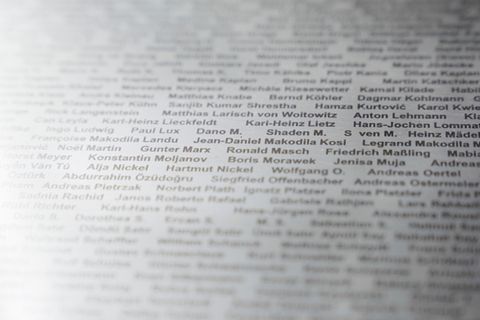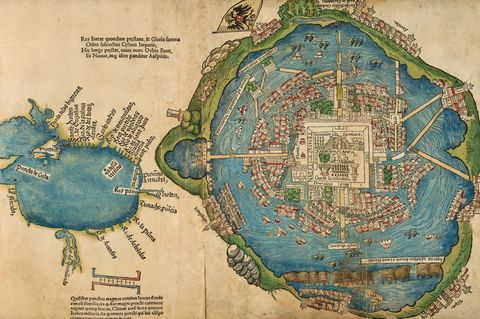GEO: Prinz Harry hat sein neues Buch "Spare" veröffentlicht und darin schwere Anschuldigungen an die britische Königsfamilie erhoben. Ist das ein Skandal – oder eher eine Verkaufsstrategie?
Steffen Burkhardt: Aus deutscher Perspektive ist Prinz Harrys Buch kein Skandal, sondern vor allem eine Verkaufsstrategie, um die persönlichen Konflikte der Königsfamilie gewinnbringend zu vermarkten. Aber aus britischer Perspektive sind die Äußerungen Harrys sehr wohl ein Skandal, weil hier eine moralische Leitvorstellung der englischen Gesellschaft verletzt wird. Skandale muss man verstehen als öffentliche Kommunikationsprozesse, öffentliche Entscheidungsprozesse, in denen die Gesellschaft ihre eigene Leitmoral aushandelt.
Welche Leitmoral hat Harry denn verletzt?
Für die englische Gesellschaft gilt die Devise, dass das Private der Königsfamilie nicht aus der Familie herausgetragen werden sollte. Man wird zum Hochverräter, indem man aus dem Nähkästchen plaudert! Gleichzeitig greift Harry mit seinen Vorwürfen auch die Monarchie an, er liefert den Anti-Monarchisten Futter. Sie können jetzt wieder die Zukunft der konstitutionellen Monarchie in Frage stellen.
Handelt es sich also um mehrere Skandale zugleich?
Das Spannende an Skandalen ist, dass sie immer viele Schichten haben. In Großbritannien wird dieser Skandal mit großer Aufmerksamkeit rezipiert, weil es auch um grundsätzliche Fragen des politischen Systems geht: Ist die Monarchie überhaupt für staatstragende Rollen geeignet? Zugleich bereichern viele Erzählstrategien diesen Skandal: Der Königssohn Harry hadert der mit seiner Rolle als verschmähter Königssohn. Seine Frau Meghan bekriegt sich mit Stiefmutter Camilla und Schwägerin Kate. Mit Harry und William liefern zwei Brüder sich eine Fehde, Harry und Charles einen Vater-Sohn-Konflikt. Der Verlust von Harrys Mutter ist nicht aufgearbeitet. Das enthält sogar eine metaphysische Dimension: Wer ist die wahre Erbin von Lady Di? All das bereichert die medialen Erzählstrategien des Skandals.

Das mag ja für die Briten interessant sein, aber warum gucken auch Deutsche so viel über den Ärmelkanal?
Erstens haben viele Familien ihre eigenen Dramen, dadurch können viele Menschen sich gut mit den Windsors identifizieren. Zweitens werden uns Erzählungen von der heilen Welt und Märchenprinzen schon mit Grimms Märchenbüchern in die Wiege gelegt; Prince Harrys Verhalten ist ein Kulturbruch. Es erlaubt uns, hinter die Fassaden zu blicken und die Erzählung der heilen Welt zu entlarven. Drittens bietet die Monarchie eine Orientierung für die Frage, wie Nachfolge und Nachfolgekonflikte geregelt werden, etwa in der Familie oder Unternehmen. Und viertens werden wir schlicht abgelenkt durch diese Geschichten: Wir flüchten uns vor unseren Alltagssorgen wie Ukrainekrieg oder Pandemie in eine beständigere Welt, nämlich die der britischen Monarchie.
Aber ein Skandal ist es in Deutschland trotzdem nicht?
Nein, denn hier werden nicht die moralischen Vorstellungen unserer Gesellschaft ausgehandelt und aktualisiert, und so richtig empört ist hier auch niemand.
Warum nicht?
Die Kernfrage, die mit diesem Skandal verknüpft ist, ist die Frage nach dem Fortbestand der Monarchie. Und die stellt sich uns in Deutschland nicht, weil wir eine andere Staatsform haben. Der Konflikt um Harry ist für uns ein medialisierter Skandal: Es wird berichtet über einen Skandal, der sich in einer anderen Gemeinschaft zuträgt.
In Großbritannien handelt es sich aber um einen vollständigen Medienskandal, also einem modernen Skandal unter dem Einfluss des Mediensystems. Journalist:innen nehmen die Rolle von Erzähler:innen ein, Akteure und Akteurinnen werden zu Held:innen und Antiheld:innen, das Publikum zu Helfer:innen. Die mediale Erzählung verbreitet sich schnell und die Betroffenen haben keine Erzählungshoheit mehr.
Skandale wie dieser wirken manchmal vorhersagbar. Gibt es feste Regeln, nach denen sie ablaufen?
Skandale verlaufen in der Regel in fünf Phasen. Sie beginnen mit einer sehr kurzen Einführungsphase. In ihr werden der Öffentlichkeit die wichtigsten Akteurinnen vorgestellt und welche Zustände, Ereignisse oder Entwicklungen problematisch sein könnten. Daraufhin richtet sich sehr schnell das öffentliche Interesse auf den Gegenstand dieser Skandalisierung.
Das führt zur zweiten Phase des Skandals, der sogenannten Aufschwungphase. Hier erfährt die Öffentlichkeit, welche Personen problematisch sind und gegen welche Moralvorstellungen sie im Detail verstoßen haben sollen. Schon mischen sich ganz viele Personen in die Skandalisierung ein. Öffentlich wird nun gewichtet und erklärt, was den Skandal so verwerflich macht.
In dieser Phase befindet sich die britische Diskussion. Was kommt dann?
In der dritten Phase werden Entscheidungen getroffen: Wer ist der Böse? Wer ist der Gute? Ist der Böse so böse, wie wir behauptet haben? An diesem Punkt ist die emotionale Erregung am höchsten. Betroffene erklären sich. Bald könnte etwa König Charles Prinz Harry von der Krönungsfeier ausschließen – und so auch symbolisch aus der Monarchie. Die einen gehen als Held oder Heldin aus dem Skandal, die anderen bleiben als Antiheldinnen zurück.
Danach folgt die Abschwungphase: Im Nachhinein wird bewertet, ob die Öffentlichkeit den Skandal richtig eingeschätzt hat und richtig vorgegangen ist. Häufig durch Medienjournalist*innen oder durch das, was wir gerade machen: Die Einordnung aus einer Metaperspektive.
Die fünfte ist die Rehabilitationsphase: Die Situation entspannt sich, eventuell wird der Ruf der betroffenen Person wiederhergestellt.
Die fünf Phasen des Skandals erinnern an Modelle des Dramas im Theater, bis hin zum griechischen Theater, das mit Aufschwung, Höhepunkt und Abschwung arbeitet. Woher die Ähnlichkeit?
Dieses Fünf-Phasen-Modell orientiert sich an der Forschung des Soziologen Niklas Luhmann, der die Lebenszyklen von Themen in der Öffentlichkeit analysiert hat. Aber tatsächlich stammt die erste Beschreibung eines Skandals vom griechischen Dichter Aristophanes, etwa 400 vor unserer Zeitrechnung: Er vergleicht einen Angeklagten vor Gericht mit einem gehetzten Tier. Der Angeklagte würde in eine Falle gedrängt, zum Skandalon – nämlich das Stellhölzchen einer Tierfalle. Wer das Skandalon berührt, für den schnappt die Falle zu.
Sind Skandale also in Wahrheit Machtinstrumente, um unliebsame Gegner loszuwerden?
Skandale sind immer ein Machtinstrument. Sie sind die Stellhölzchen der Macht. Es gibt aber auch keinen Skandal ohne Menschen, die sich über die Moral streiten. Das Spannende ist, dass durch die Diskussionen auch neue Gemeinschaften entstehen: Eine Meghan-und-Harry-Fraktion genauso wie eine William-und-Kate-Fraktion.
Ein Skandal spaltet die Gesellschaft – und bringt sie gleichzeitig auch wieder in neuen Gemeinschaften zusammen?
Absolut. Sie haben das Potenzial, neue moralische Kollektive zusammenzubringen und den moralischen Code zu aktualisieren. Etwas, was vor zehn Jahren Skandal war, muss heute keiner mehr sein. Das macht die Forschung über Skandale so spannend: Sie sind wie Radarfallen der Gesellschaft. Aus diesen Blitzaufnahmen können wir in der Forschung die moralischen Grundsatzkonflikte in Gesellschaften herausarbeiten.
Welcher Skandal hat Sie besonders beeindruckt?
Ein für mich sehr spannender Skandal ist die Affäre um den Juden Alfred Dreyfus in Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts. Ihm wurde Spionage vorgeworfen, obwohl er unschuldig war. Es kam zu antisemitischen Vorwürfen und er wurde trotz seiner Unschuld wegen Landesverrats verurteilt. Émile Zola hat dann in seinem berühmten Zeitungsessay „J’accuse“, „Ich klage an“, dem Staat, der Justiz und der Zivilgesellschaft ihr Versagen vorgeworfen. Am Ende wurde Dreyfus rehabilitiert.
Was ist an diesem Fall so spannend?
Es handelt sich um den ersten großen Medienskandal in Europa, und er führte in Frankreich zu einer strikten Trennung von Moral und Recht, was in Deutschland nicht der Fall ist: Bei uns fordert man bis heute sehr schnell Rücktritte auf Basis von Moral, auch wenn nicht gegen geltendes Recht verstoßen wurde. Das ist ein hochinteressanter Skandal, weil er im internationalen Vergleich zeigt, wie umfassend die Auswirkungen von Skandalen sein können.
Wünschen Sie sich manchmal eine Welt ohne Skandale?
Nein, weil sie zeigen, dass in der Öffentlichkeit über grundsätzliche Fragen des Zusammenlebens gestritten wird. Und das ist sehr gut an Skandalen. Sie zeigen uns, dass wir miteinander im Gespräch sind als Gesellschaft. Und das hat eine zutiefst wichtige Funktion für den Zusammenhalt. Journalismus könnte häufiger daran arbeiten, diese Funktion offenzulegen und die impliziten moralischen Fragen als ethische Fragen zu besprechen. Am Skandal lässt sich zugleich sehen, welche grundsätzlichen Probleme im gesellschaftlichen System und im Mediensystem existieren.
Warum also lieben und hassen wir Skandale so? Warum haben wir ein so intensives Verhältnis zu Skandalen?
Skandale wühlen uns auf. Sie können ungeheure moralische Empörung auslösen, sie betreffen Grundfragen unseres Zusammenlebens. Wir brauchen sie, um diese Grundfragen zu diskutieren, am konkreten Fall. Aber wir sind abgestoßen von ihnen, wenn es ans Eingemachte geht.
Und was bleibt übrig nach einem Skandal?
Die Moral von der Geschicht.