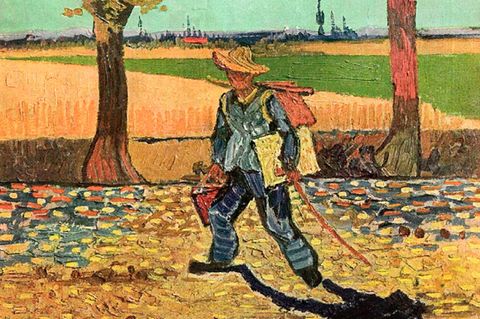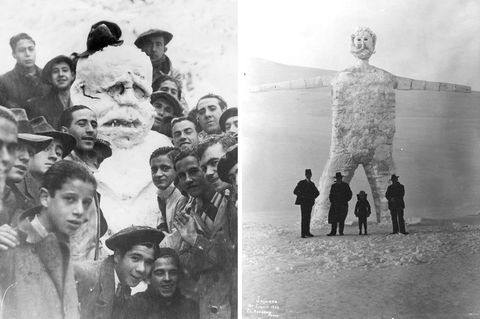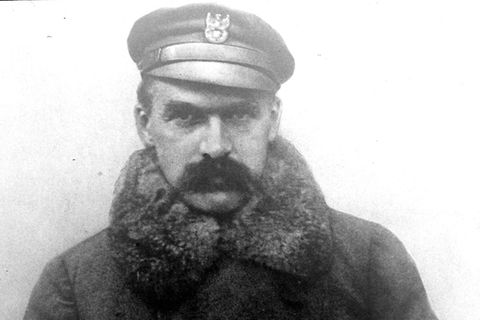GEO: Herr Dr. Haßmann, bei Borsum im Landkreis Hildesheim hat ein privater Sondengänger vor acht Jahren in einem Waldstück einen Silberschatz aus der Römerzeit ausgegraben, aber erst jetzt den Behörden gemeldet. Was heißt das für Sie als Landesarchäologe Niedersachsens?
Dr. Henning Haßmann: Dass der Fundzusammenhang zerstört ist, also wie er im Boden lag. Für uns liegt der eigentliche Wert dieses Fundes ja nicht im Wert der 450 Silbermünzen. Uns geht es darum, eine historische Nuss zu knacken, Mosaiksteinchen zu einem Geschichtspuzzle zusammenzusetzen, das eine breitere Sicht auf die Dinge erlaubt.
Und zwar?

Es handelt sich um einen Hort mit eindeutig römischen Artefakten, wahrscheinlich aus der Zeit um Christi Geburt, aber hat ein Römer diese Münzen niedergelegt oder ein Germane? Hat jemand diese Münzen versteckt, um sie später irgendwann zu holen, wenn sich etwa die politische Situation verändert hat? Hatte das Vergraben der Münzen in eine Art Tresorfunktion? Oder handelt es sich um eine kultische Niederlegung an die Götter?
Und da macht es einen Unterschied, ob Sie die Münzen ausgraben oder ein Laie?
Wir können zum Beispiel Bodenverfärbungen lesen: Selbst wenn Holz im Laufe der Zeit vergangen ist, können wir über Verfärbungen im Boden manchmal Pfosten nachweisen. Das würde bedeuten, dass dort einmal ein Gebäude gestanden haben könnte. Es könnte auch sein, dass an dieser Stelle eine knorrige Eiche stand und die Person den Schatz gerade deshalb dort versteckt hat. Es kommt uns darauf an, genau zu verstehen, wie die Objekte angeordnet waren. In einer Kiste? Einem Gefäß? Manchmal finden wir Textilreste, aus denen wir schließen können, dass die Münzen etwa in einem gewebten Leinenbeutel lagen. In diesem Fall aber sind diese Informationen verloren.

Immerhin wurden der Fund und der Fundort überhaupt nachträglich gemeldet.
Zum Glück hat der reuige Finder alles abgegeben und den Fundort gemeldet. Manche privaten Sondengänger machen sich nicht klar, warum es so wichtig ist, Funde und ihren Fundort unbedingt zu melden. Alles, was jemand aus dem Boden reißt und mitnimmt, entzieht sich unserer Auswertung. Historische Quellen wachsen nicht nach, sie sind wie eine aussterbende Tierart.
Andererseits profitiert die Forschung auch von den Funden privater Schatzsucher. Sind diese Sondengänger Fluch oder Segen für die Archäologie?
Beides. Ich halte ehrenamtliche Sondengänger, die sich an die Regeln halten, für die Forschung für unverzichtbar. Viele bedeutende Funde gehen auf Entdeckungen durch Privatleute zurück, etwa die Schlachtfelder von Kalkriese oder am Harzhorn im südlichen Niedersachsen, wo im 3. Jahrhundert Römer gegen Germanen gekämpft haben. Durch diesen dann von Profis untersuchten Fundplatz hat sich das Bild von den Römern in Norddeutschland völlig verändert. Das bronzezeitliche Schlachtfeld im Tollensetal wurde ebenfalls nicht etwa von Forschenden entdeckt, sondern von ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern. Allein in Niedersachsen melden uns Sondengänger jedes Jahr an die 1000 neue Fundstellen! Dieses bürgerschaftliche Engagement hilft uns, unsere Kartenbilder zu verdichten und die Vergangenheit besser zu verstehen. Problematisch sind die Leute, die ihre Funde aus dem Boden reißen und nicht melden. Die Meldepflicht von Bodenfunden gilt übrigens in allen Bundesländern.
Was treibt die illegalen Sondergänger an?
Es gibt unterschiedliche Gruppen: Manche Leute sammeln alle möglichen Weltkriegs-Dinge. Doch wenn sich jemand einfach Erkennungsmarken gefallener Soldaten aneignet, ohne sie zu melden, ist das verwerflich, weil so die Aufklärung von Vermisstenschicksalen verhindert wird. Die Denkmalpflege meldet solche Marken an Spezialisten, die so Familienangehörigen auch Generationen später Gewissheit über das Schicksal ihres Vorfahren geben können.
Was gibt es noch für Gruppen?
Sondengänger mit krimineller Energie könnten gezielt nach explosiver und zuweilen verwendbarer Weltkriegsmunition suchen, um diese zu verkaufen oder gar einzusetzen. Wieder andere verticken ihre Funde auf dem Antiquitäten-Schwarzmarkt, vor allem im Internet. Und dann gibt es noch die „Influencer“: Die drehen Videos, präsentieren ihre Funde im Netz, wetteifern um Klickzahlen und ringen nach Berühmtheit. Insgesamt aber hat das Bewusstsein dafür, wie wichtig Funde im Boden für unsere Geschichte sind, in den vergangenen Jahren zugenommen.
Der Denkmalschutz ist Sache der Bundesländer und jedes Land entscheidet selbst über die Zusammenarbeit mit privaten Sondengängern. In Niedersachsen benötigen Sondengänger eine Genehmigung, bevor sie losziehen dürfen. Außerdem ist die Teilnahme an einem Sondenkurs obligatorisch. Was lernt man dabei?
Mit einem Metalldetektor loszuziehen, bedeutet auch Verantwortung. Der Sensibilisierungskurs hat einen theoretischen und einen praktischen Teil; die Teilnahme wird bescheinigt. Nach einer Einführung in die Archäologie geht es um rechtliche Grundlagen, also was erlaubt ist und was nicht. Man muss auch erst mal lernen, eine Sonde richtig zu halten und einzustellen. Vermittelt wird ein Gespür für Landschaft, für die Art der Begehung, um erfolgreich zu sein. Es wird auch erläutert, wie Funde eingemessen werden und gegebenenfalls konservatorisch zu behandeln sind. Wichtig sind die Hinweise auf Gefahren durch Kampfmittel im Boden.
Und dann?
Dann kann man eine Suchgenehmigung beantragen. Die Sondengänger bekommen für ein bestimmtes Gebiet eine Genehmigung, dieses in einem zeitlich befristeten Rahmen abzusuchen. Mit der Meldung ihrer Funde leisten sie einen Beitrag zur Erforschung unserer Vergangenheit.