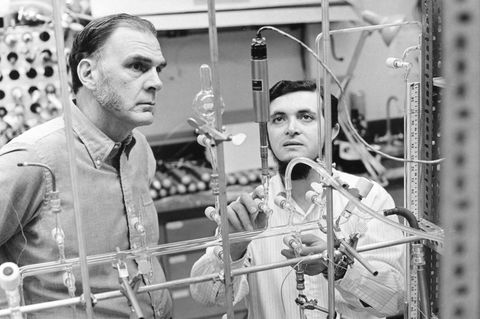Der Kampf gegen das Ozonloch gilt als durchschlagender Erfolg der internationalen Umweltdiplomatie und -politik. Wichtigster Erfolgsfaktor: ein weitgehendes Verbot jener Stoffe, die in die Atmosphäre gelangen und die Ozonschicht schädigen. Nun haben sich einer Studie zufolge trotz aller Bemühungen in den vergangenen Jahren fünf langlebige, ozonabbauende Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in der Atmosphäre immer stärker angereichert.
Die Emissionen stammten wohl hauptsächlich aus Prozessen, die nicht den derzeitigen Kontrollen des Montrealer Protokolls unterliegen, erläutert ein Forschungsteam im Fachjournal "Nature Geoscience". Noch seien die Auswirkungen der Gesamtemissionen der fünf FCKW auf die Ozonschicht gering. Ein kontinuierlicher Anstieg in der derzeitigen Geschwindigkeit könne jedoch einen Teil der erzielten Fortschritte zunichtemachen und zusätzliche Klimaauswirkungen haben.
1987 hatten sich zahlreiche Länder im Montreal-Protokoll auf ein Ende der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) verständigt, weil sie die Ozonschicht schädigten. Diese Schicht in der Erdatmosphäre schützt die Erde vor ultravioletter Strahlung der Sonne (UV). Seit 2010 gilt weltweit ein Produktionsverbot für FCKW, die früher unter anderem als Kältemittel, in Spraydosen und für Kunststoffschäume verwendet wurden.
FCKW können aber immer noch als Ausgangsstoffe, Zwischen- oder Nebenprodukte bei der Herstellung anderer Chemikalien freigesetzt werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Luke Western von der University of Bristol hatten anhand von Messungen an 14 Standorten weltweit untersucht, wie sich die Menge an FCKW-113, FCKW-112a, FCKW-113a, FCKW-114a und FCKW-115 zwischen 2010 und 2020 verändert hat.
Im Jahr 2020 erreichten demnach alle fünf Gase ihren höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen durch direkte Messungen (1978 für alle Gase mit Ausnahme von FCKW-112a, das seit 1999 erfasst wird). FCKW-113a, FCKW-114a und FCKW-115 werden bei der Herstellung anderer Chemikalien verwendet - wahrscheinlich bei der Produktion von Fluorkohlenwasserstoffen (FKW), die die FCKW für viele Anwendungen ersetzt haben, wie die Wissenschaftler erläutern. Für FCKW-112a und FCKW-113 sei kein aktueller Verwendungszweck bekannt, der Ursprung des Anstiegs sei hier unklar. Mögliche Ursachen seien etwa der gezielte Abbau anderer FCKW oder eine Entstehung als Nebenprodukt.
Lebensdauer bis zu 640 Jahren
Die fünf Substanzen haben den Angaben zufolge eine atmosphärische Lebensdauer von 52 bis 640 Jahren - schaden der Ozonschicht also über lange Zeiträume. Den Studienergebnissen zufolge entsprach die Gesamtemission der fünf FCKW im Jahr 2020 dem Äquivalent von 4200 Tonnen FCKW-11, dem am zweithäufigsten vorkommenden Fluorchlorkohlenwasserstoff. Beim Erwärmungseffekt gehen die Autoren von 47 Millionen Tonnen CO2 aus - was 150 Prozent der CO2-Emissionen Londons im Jahr 2018 entspreche.
"Angesichts des kontinuierlichen Anstiegs dieser Chemikalien in der Atmosphäre ist es vielleicht an der Zeit, über eine Verschärfung des Montrealer Protokolls nachzudenken", sagte Mitautor Johannes Laube vom Forschungszentrum Jülich.
Die fünf FCKW sind nicht die einzigen Substanzen, die Experten mit Blick auf das Ozonloch Sorgen bereiten. Im Fachblatt "Nature Communications" schrieb ein britisch-chinesisches Forschungsteam Ende 2021, dass sich der Ausstoß von Dichlormethan (CH2Cl2) in China binnen acht Jahren fast verdreifacht habe. Das könne die Erholung der Ozonschicht je nach weiterer Entwicklung der Emissionen um bis zu 30 Jahre verschieben, so die Gruppe um Minde An von der Universität Peking.
Das in der Industrie unter anderem als Lösungsmittel eingesetzte Dichlormethan zählt zu den Substanzen, die in der Atmosphäre binnen sechs Monaten abgebaut werden - solche kurzlebigen Verbindungen sind nicht vom Montrealer Protokoll betroffen.
Ebenfalls China war der Verursacher einer Anreicherung von Trichlorfluormethan (FCKW-11) in der Atmosphäre, das zu den verbotenen FCKW gehört. In der Zeit von 2013 bis 2018 hatten Forscher aus mehreren Messungen geschlossen, dass die Substanz im Osten Chinas trotz internationalem Verbot weiter produziert und verwendet wurde, in den Jahren darauf ging der Ausstoß dann wieder zurück.
Erst im Januar hatte es von den Vereinten Nationen dennoch geheißen, die Ozonschicht sei derzeit auf gutem Weg, sich innerhalb der kommenden Jahrzehnte zu erholen. Werde der derzeitige Weg beibehalten, dürfte sich die Ozonschicht demnach bis etwa 2066 in der Antarktis, bis 2045 in der Arktis und bis 2040 im Rest der Welt auf den Stand von 1980 erholen - das war vor der Bildung des Ozonlochs.
Der Schutz vor UV-Einstrahlung hat neben dem direkten Schutz etwa vor Hautkrebs eine weitere wichtige Wirkung: Ohne das Montrealer Protokoll hätte sich die Erde bereits deutlich stärker erwärmt, wie ein Forschungsteam 2021 berichtete. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts hätten FCKW und ähnliche Substanzen demnach einen zusätzlichen Temperaturanstieg um 2,5 Grad bewirkt.
In der Studie wurde modelliert, wie stark das Pflanzenwachstum abgenommen hätte, wenn eine ausgedünnte Ozonschicht die Erde weniger vor UV schützen würde. Bei geringerem Pflanzenwachstum wird weniger Kohlendioxid (CO2) in Pflanzen gebunden. Zudem sind bestimmte ozonzerstörende Substanzen auch äußerst wirksame Treibhausgase.