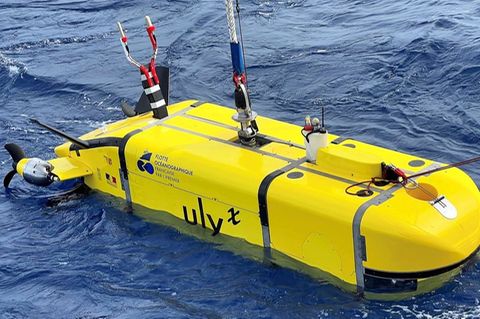Methan kann entsteht, wenn organische Bestandteile wie Blätter ohne Luftzufuhr verrotten. Daher entlassen auch Sümpfe, Wälder oder auftauende Permafrostböden Methan in die Atmosphäre.
60 Prozent der globalen Methanemissionen gehen allerdings auf den Menschen zurück: Es bildet sich beispielsweise in Mülldeponien und entweicht. Zu den größten Emissionsquellen gehören die vielen Kuhherden, die in der industriellen Landwirtschaft gehalten werden. In Deutschland ist der Agrarsektor mit über 1200 Kilotonnen (2020) der größte Treiber der deutschen Methan-Emissionen. Eine naheliegende Maßnahme wäre daher, den Tierbestand zu reduzieren. Mehr Weidehaltung, Änderungen am Futter oder in der Züchtung können zusätzlich bei der Reduktion helfen.
Auch der Energiesektor setzt Methan frei, zum Beispiel beim so genannten Flaring von Erdgas oder durch Lecks an Pipelines. Es gibt jedoch ein Problem: Methan-Quellen und Lecks bleiben oft unerkannt. 2022 etwa registrierte ein Instrument auf der ISS zufällig über 50 Methan-Quellen. Und bis jetzt weiß niemand so genau, wie viele Lecks es überhaupt gibt. Nach ersten Tests könnte es über 1000 Mal so viele Lecks geben, wie bisher angenommen. Wie lassen sich solche unerkannten Emissionen reduzieren? Antworten gibt es im Klima Update Spezial.