GEO.de: Während Tierschützer*innen um jeden Quadratzentimeter Platz für Schweine und Hühner ringen, fordern Sie in Ihrem neuen Buch den kompletten Ausstieg aus der sogenannten Nutztierhaltung. Ist das nicht an der Realität vorbei?
Friederike Schmitz: Es ist auf jeden Fall quer zur Realität der aktuellen politischen Diskussion, unter anderem, weil die Forderung kaum diskutiert wird. Angesichts der Probleme, die die Tierhaltung mit sich bringt, ist die Forderung aber angemessen. Ich finde es eigentlich umgekehrt, unrealistisch zu denken, dass die Tierindustrie einfach so weitermachen könnte. Natürlich lässt sich der Ausstieg nicht innerhalb eines Jahres umsetzen. Deshalb sage ich: Was wir zunächst brauchen, ist eine drastische Reduktion der Tierzahlen. Das halte ich für realistisch. Es ist möglich und machbar – und es gibt gute Gründe dafür.
Welche sind das?
Da sind zum einen Gesundheitsgefahren, die aus der Tierhaltung selbst resultieren. Zum Beispiel, indem sich neue Zoonosen entwickeln oder Antibiotikaresistenzen entstehen. Dazu kommen die negativen gesundheitlichen Effekte eines hohen Konsums von Tierprodukten. Das zweite Thema sind die Auswirkungen auf das Klima und die Artenvielfalt: Eine globale Umstellung auf vegane Ernährung könnte die Klimagas-Emissionen der Menschheit um 28 Prozent reduzieren. Und 60 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Deutschland dienen der Tierhaltung. Da hätten wir also einen wichtigen Hebel, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Nicht zuletzt ist da noch das tierethische Argument: Wie krass die Tiere leiden, das wird allgemein unterschätzt oder beschönigt. Auch ein Mehr an sogenanntem Tierwohl kann daran kaum etwas ändern. Wenn man Tiere als fühlende Lebewesen ernst nimmt, darf man sie nicht als Lieferanten von Produkten ausbeuten.
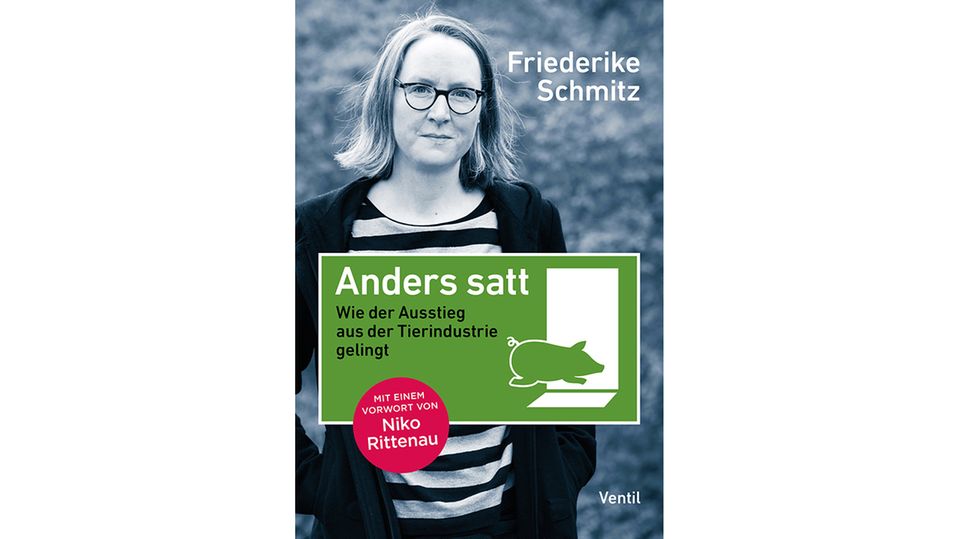
Für einen Ausstieg bräuchte es eine Mehrheit. Haben Sie die Menschen in Deutschland auf Ihrer Seite?
Teils teils. Fast niemand ist wohl damit einverstanden, wie Tiere in der Tierindustrie behandelt werden. Genauso wie es niemand gut findet, dass der Planet für zukünftige Generationen zerstört wird. Auf der Überzeugungsseite sind die meisten Menschen vermutlich sehr nah an meiner Position – aber nicht im Handeln. Das liegt aber auch an Faktoren, die sich verändern lassen, an Gewohnheiten und Geschmacksvorlieben. Und mit dem richtigen Framing, also der Art, wie man über das Thema spricht, lässt sich mehr Zustimmung gewinnen. Wir sollten also nicht nur moralisch bewerten, was der oder die andere isst, sondern das Thema als gemeinschaftliche Aufgabe ansprechen, die nur gemeinschaftlich zu lösen ist. Ein gutes Beispiel sind für mich Bürgerräte, die auch zu weitreichenden Forderungen kommen, was die Zahl der Tiere und den Konsum von Tierprodukten betrifft.
Kürzlich sorgte die Nachricht für Aufregung, in Freiburger Kitas und Grundschulen bekämen Kinder zukünftig nur noch vegetarisches Essen. Können Sie die Empörung mancher Eltern verstehen?
Ja, ich kann das nachvollziehen, denn Freiheit ist ein wichtiges Gut. Allerdings wird die Wahl zwischen Pflanzen- und Fleischkost als eine Art zentrale Freiheit präsentiert. Dabei können wir in vielen Belangen überhaupt nicht mitbestimmen, zum Beispiel, woher das verwendete Fleisch stammt oder wie die Tiere behandelt werden. Vor der individuellen Entscheidung für ein Tagesgericht gibt es also schon viel Unfreiheit, über die sich viel zu wenig aufgeregt wird. Zudem hat es für den Schritt der Stadt Freiburg sicher auch viel Zustimmung gegeben – er ist ja allein aus Klimasicht für die Zukunft der Kinder selbst genau das Richtige. Das darf man nicht vergessen, wenn einige laut aufschreien.
Vermutlich geht es dabei nicht nur um Wahlfreiheit, sondern auch um den sozialen Stellenwert von Fleisch als Nahrungsmittel …
Natürlich. Der Konsum von Fleisch ist mit gesellschaftlichen Werten und mit Ideologie aufgeladen. Wenn entschieden worden wäre: "Es gibt nie wieder Rote Bete", wäre der Aufschrei ausgeblieben.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat gezeigt, wie abhängig unsere Tierproduktion von Getreideimporten ist. Doch statt auf eine Reduktion der Tierzahlen zu setzen, wurden Umweltauflagen zugunsten der Futterproduktion gesenkt. Eine vertane Chance für die Transformation?
Ja. Es ist typisch für solche Krisen, dass sie beide Seiten stärken: Einerseits wurden die Gründe für einen Wandel für die Öffentlichkeit sichtbar. Doch die Verteidiger des Status Quo haben die Krise für ihre Argumentation genutzt, wir bräuchten jetzt alle denkbaren Flächen für die Futtermittelproduktion – auch zu Lasten der Artenvielfalt. Und damit hatten sie Erfolg. Da müssen die Machtverhältnisse verschoben werden.
Unsere niederländischen Nachbarn haben schon beschlossen, die Tierbestände drastisch zu reduzieren, wegen zu hoher Stickstoffbelastungen in vielen Regionen. Schätzungsweise ein Drittel aller Tierhalter werden ihren Betrieb aufgeben müssen. Es gab schon gewaltsame Proteste. Was läuft da falsch?
Ich vermute, die Regierung hat nicht ausreichend darauf geachtet, die Transformation so zu gestalten, dass die Tierhalter*innen sich fair behandelt fühlen. Es gibt zwar ein Entschädigungsprogramm, aber trotzdem sind die Sorgen groß, dass die Alternativen nicht existenzsichernd oder attraktiv sein werden. Auch kommen neue Regelungen scheibchenweise, was Unsicherheit erzeugt. Die Regierung müsste also klarer kommunizieren und gute Angebote schaffen. Ein gewisses Maß an Ablehnung wird die Regierung allerdings aushalten müssen. Es gibt viele Mythen und Falschdarstellungen rund um die Tierhaltung und das Stickstoffproblem. Man wird nicht alle Landwirt*innen aus ihren Informations-Blasen herausholen und mitnehmen können.
Ihr Ausgangspunkt als Philosophin und Tierethikerin ist das Leid der Tiere. Was macht Ihnen Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit gelindert wird?
Es gibt viele kleine positive Veränderungen, gerade beim Konsum. Die öffentliche Diskussion über die sogenannten Nutztiere und den Konsum von tierischen Produkten hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Nun würde es natürlich viel zu lange dauern, wenn die Transformation nur in solchen kleinen Schritten vorankäme. Aber gesellschaftliche Veränderungen verlaufen nicht linear. Krisen können Veränderungen anstoßen und beschleunigen. Es sieht zwar momentan schlecht aus für die Tiere. Aber es ist nicht aussichtslos, und ein Wandel ist möglich. Und weil es so wichtig ist, lohnt es sich, sich dafür einzusetzen. Wenn mehr Menschen das tun, kann auch in kurzer Zeit eine ganz neue Dynamik entstehen.




























