Der Beitrag ist ein Kapitel aus dem Buch "Nutztiere: Mehr als eine Frage der Haltung" von Bernward Geier, Stefanie Pöpken und Renate Künast. Es ist am 15. Januar im Westend-Verlag erschienen.
Verwenden wir den Begriff Massentierhaltung, so machen wir uns von den Protagonist*innen der jetzigen Tierhaltungssysteme leicht angreifbar, denn der Begriff "Masse" müsste für jede Tierart gesondert definiert werden, was bisher nicht gelungen ist. Und natürlich gibt es auch große Tierbestände, die den hohen Ansprüchen an Haltung, Zucht, Fütterung und Tiergesundheit gerecht werden. Dies gelingt aus meiner Sicht aber nur in geschlossenen Betrieben, also in Betrieben ohne Zukauf, alle Tiere bleiben nach ihrer Geburt bis zu Schlachtung im Betrieb. Beispiel hierfür ist der Bio-Schweinebetrieb Hestbjerg Ökologi in Denmark mit 1.200 Muttersauen, 30.000 Mastplätzen.
Daher sprechen wir von industrieller Landwirtschaft. Dieser Begriff zeigt alle Ursachen auf, die zu den Zuständen geführt haben, die wir heute sehen, und unter denen die Tiere, die Umwelt, das Klima und nicht zuletzt alle Menschen und auch die Bäuerinnen und Bauern, leiden. Der große Erfolg der industriellen Entwicklung lag darin, dass die Produktion in viele kleine, sehr effektive und deshalb kostenreduzierende Schritte aufgeteilt wurde. Bäuerliche, überschaubare Betriebe wurden in diese industriellen Systeme integriert und sind damit leider Teil davon.
Gleichzeitig wurde alles unternommen, um menschliche Arbeitskraft durch Technik, Maschinen und simple Routinen zu ersetzen. Nicht nur in Kauf genommen, sondern gewünscht war und ist es, dass möglichst einheitliche Produkte entstehen. Vielfalt stört die industrielle Produktion von Lebensmitteln. Diese Produktionsweise benötigt simple, immer gleiche, möglichst einfache Abläufe.
Das Beispiel "industrielles" Geflügel
Beim Geflügel zeigt sich der höchste Spezialisierungsgrad. Es gibt Betriebe, die die Mutter- beziehungsweise die Vaterlinien halten und damit Küken produzieren. Die Genetik dafür liegt weltweit in den Händen von vier Konzernen. Die Eier aus den Kreuzungen sind immer Hybride. Die Eigenschaften der Vater- und Mutterlinien führen zu mehr Fleisch, mehr Eiern, als dies bei den Elterntieren der Fall ist. Eine Weiterzucht mit diesen Tieren, Hybriden, macht keinen Sinn. Diese Hybrid-Eier gehen in spezialisierte Brütereien. In diesen Brütereien schlüpfen die Küken. Bis vor Kurzem wurden auch bei uns in Deutschland die männlichen Küken bei der Legehennen-Zucht getötet – und das hieß lange Zeit lebendig geschreddert. Bei uns ist das Töten männlicher Küken mittlerweile verboten, aber in der EU respektive weltweit ist das nach wie vor die Regel. Die einen Tag alten weiblichen Küken werden zu spezialisierten Aufzuchtbetrieben transportiert. Sobald sie beginnen, Eier zu legen, liefern diese Betriebe die jungen Hühner dann an Legehennen-Halter*innen.
Welche Dimensionen der Wahnsinn solcher Transporte haben kann, zeigte sich zum Beispiel, als am 9. August 2013 eine Antonow 12 mit 49.000 Küken an Bord auf dem Flughafen Leipzig in Flammen aufging. Die Küken sollten in die Ukraine geflogen werden.
Die Folge dieses Systems ist, dass der Einsatz von Antibiotika in der Geflügelhaltung konstant hoch ist, insbesondere der Einsatz von Reserveantibiotika, zum Beispiel Colistin. Bei den Pleuromutilinen, einem sehr neuen Antibiotikum, das erst seit 2007 angewendet wird, meist über das Trinkwasser, hat die Anwendung sogar noch zugenommen. Die Wartezeit auf essbares Gewebe nach der Anwendung dieses Antibiotikums ist lediglich drei Tage. Die Eier der mit diesem Antibiotikum behandelten Legehennen unterliegen keiner Wartezeit, sie dürfen während der Behandlung in den Verkehr gebracht werden.

Rupert Ebner ist unabhängiger Tierarzt für Großtiere und Nutztiere in der Landwirtschaft. Der Tiermediziner war lange Vizepräsident der Bayerischen Landestierärztekammer, Umwelt- und Gesundheitsreferent der Stadt Ingolstadt und ist bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft aktiv
Beim Geflügel zeigt sich inzwischen außerdem deutlich, dass die Impfung ihre "Unschuld" verloren hat. Seit Corona wissen wir alle, wie variabel Viren sind. Sie entwickeln immer neue Varianten und deshalb müssen auch immer wieder neue Impfstoffvarianten entwickelt werden. Virus-Mutationen gibt es besonders häufig in großen Beständen. Die entstandenen Varianten bedrohen natürlich auch kleine, bäuerliche Bestände. Die immer wieder neu entwickelten Impfstoffe werden aber nur in großen Gebinden (für 10.000 Tiere und mehr) hergestellt und müssen dazu noch in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Diese Entwicklung bedroht die gesamte bäuerliche Rassegeflügelzucht, da diese Impfstoffe für diese Betriebe unerschwinglich sind.
Bei Schweinen und Rindern läuft es ähnlich
Auch bei Schweinen wird nach dem Prinzip der industriellen Arbeitsteilung verfahren. Stufe 1. Eberzüchter*innen, 2. Zuchtsauen–Produzent*innen, 3. Ferkelerzeuger*innen, 4. Babyferkel-Halter*innen, Mäster*innen.
Neben dem hohen Antibiotikaeinsatz in der industriellen Schweinehaltung ist der strategische und generelle Einsatz eines aus tierquälerischer Pferdehaltung gewonnenen Hormons zur Steuerung der Brunst ein Thema, das endlich öffentlich diskutiert wird.
Das Hormon PMSG – Pregnant Mare Serum Gondatropin – wird aus dem Blut schwangerer Stuten gewonnen, viel zu häufig und viel zu viel pro Stute. Nachdem an den Fohlen der Stuten kein Interesse besteht, wird deren Fetus nach Ende der Nutzungszeit – also des Zeitraums, in dem man das Hormon "abzapfen" kann – abgetrieben.
Der Rinderbestand von weltweit circa einer Milliarde Tiere teilt sich weitgehend in Fleischrinder und Milchrinder auf. Mit etwa 260 Millionen sind mehr als ein Viertel davon Milchkühe. Bei den Rindern hat sich ebenfalls die industrielle Aufteilung durchgesetzt. Hier gibt es Bullenaufzüchter*innen, Bullenmäster*innen, Aufzüchter*innen von weiblichen Rindern und sogenannte "Fressererzeuger*innen".
Am Beispiel der Fressererzeuger*innen lässt sich besonders eindrucksvoll darstellen, welche Folgen die industrielle Arbeitsweise in Bezug auf die Tiergesundheit und damit den Einsatz von Tierarzneimitteln, insbesondere von Antibiotika hat.
Betrieben, die weltweit die mit Abstand am häufigsten verbreitete Milchrinderrasse der Holstein-Friesen halten, haben in der Regel keine Verwendung für die männlichen Kälber. Im "Säuglingsalter" von drei Wochen müssen die Kälber den Betrieb, in dem sie geboren wurden, verlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt ernähren sich die Kälber fast ausschließlich von "Milch". In der Regel allerdings nicht von der Milch ihrer Mutter oder überhaupt von Kuhmilch, sondern sie werden mit einer mit großem Energieaufwand industriell hergestellten Ersatzmilch, dem sogenannten Milchaustaucher, getränkt.
Große Handelsunternehmen sammeln dann diese Kälber ein und verbringen sie in spezialisierte Betriebe die aus den Saugkälbern sogenannte "Fresser" machen. Das Know-how dieser Betriebe besteht vor allem darin, die Ernährung durch Milchaustauscher sofort zurückzufahren und auf eine Ernährung mit speziellem "Kraftfutter", nämlich Heu und Silage, umzustellen. Denn wenn das Kalb kein Saugkalb mehr ist, also keine Milch mehr bekommt, kann man hohe tägliche Zunahmen durch Silage und Kraftfutter erreichen. Diese Kälber werden dann als "Fresser" bezeichnet und für die Endmast an Bullenmäster*innen ausgeliefert. Dabei ist es nichts Ungewöhnliches, dass ein Kalb zweimal durch ganz Deutschland transportiert wird.
Bei der traditionellen Haltung von Milchkühen mit sogenannten Zweinutzungsrassen, die sowohl für die Fleisch- als auch für die Milcherzeugung gehalten werden, war und ist das männliche Kalb wertvoll. Es bescherte den Milchviehhalter*innen ein nicht unerhebliches weiteres Einkommen neben seinen Einnahmen aus dem Verkauf von Milch. Die männlichen Kälber der Hochleistungsrasse Holstein-Friesen oder auch von Jersey-Kühen sind für den Betrieb nicht nur wertlos, sondern ein Kostenfaktor, der "entsorgt" werden muss.
Das Pharma-Desaster
Die wenige Zeit, die für die Betreuung der männlichen Kälber in überwiegend großen Mastbetrieben aufgewendet wird, führt häufig dazu, dass Erkrankungen wie zum Beispiel ein banaler Durchfall zu spät erkannt werden und das Kalb daran verenden kann. Häufig wird auch aus Kostengründen kein Tierarzt oder keine Tierärztin hinzugezogen oder die Tierhalter*innen behandeln die Tiere mit von spezialisierten Tierarztpraxen zur Verfügung gestellten Medikamenten, meist Antibiotika und Schmerzmittel, selbst.
Gelangen sie dann auf den oft viele Stunden langen Transport, ist das neben der Verletzungsgefahr ein Stressfaktor, der auch Krankheiten hervorrufen kann. Außerdem kommt es im aufnehmenden Fresserbetrieb zu Kontakten mit Tieren aus zahlreichen Herkunftsbetrieben, was ebenfalls einen hohen Infektionsdruck hervorruft.
Der strategische Einsatz von Antibiotika, wie der prophylaktische Einsatz verharmlosend genannt wird, ist auch bei besten hygienischen Gegebenheiten nahezu in 100 Prozent der Betriebe die Regel.
Seit der Amtszeit der ehemaligen Landwirtschaftsministerin Renate Künast (2001 bis 2005) ist der prophylaktische Einsatz von Antibiotika verboten. Die Pharmaindustrie und die Behörden fanden aber schnell einen Ausweg, der Prophylaxe weiterhin ermöglicht. Das Kind hat nur einen anderen Namen, denn es heißt jetzt Metaphylaxe. Die Definition für Metaphylaxe lautet: "Wird bei einem Tier einer Gruppe ein krank machender Erreger nachgewiesen, so kann die ganze Gruppe mit dem entsprechend wirksamen Antibiotikum behandelt werden." In einer zusammengewürfelten Gruppe aus Hunderten oder Tausenden von Tieren wird sich immer ein Erreger finden, der eine Metaphylaxe legalisiert.
In den Griff bekommen wollte man den weiterhin horrenden Einsatz von Antibiotika nun durch die Vorschrift für sogenannte Anwendungs- und Abgabebeleg. Tierärztinnen und -ärzte sowie Landwirt*innen müssen nun jede Anwendung eines Tierarzneimittels umfangreich dokumentieren. Damit wurde ein Bürokratiemonster geschaffen, dessen Überprüfung die Veterinärbehörden nicht leisten können. In der Regel werden, wenn überhaupt, nur die dokumentierten Daten auf Plausibilität überprüft. Die damit behandelten Tiere sind zum Zeitpunkt der Überprüfung meist längst geschlachtet. Ob der Einsatz tatsächlich fachlich nach den Regeln der tierärztlichen Kunst notwendig war, kann damit natürlich nicht mehr überprüft werden.
Seit 2011 werden die Abgabemengen von Antibiotika in Tonnen erfasst. Der Rückgang von 1705 Tonnen 2011 auf 540 Tonnen 2022 erscheint auf den ersten Blick erfreulich, ist aber offensichtlich nicht aussagekräftig. Allein von 2014 auf 2015 gab es einen Rückgang um über 400 Tonnen, wofür niemand eine Erklärung hat. Ob die Erfassung in Tonnen überhaupt einen Sinn macht, darf bezweifelt werden, denn die Dosierungen schwanken je nach Wirkstoff von 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bis zu 400 Milligramm.
Seit Beginn 2023 werden nun sogenannte Medikamenten-Wirktage pro Tier erfasst. Dies klingt nach einer sinnvollen Maßnahme, aber ob dieses neue Bürokratiemonster wirklich verwertbare Ergebnisse erzielen kann, muss sich noch zeigen. Die Bayerische Staatsregierung hat schon mal angekündigt, dass sie die nun vorliegenden Ergebnisse erst 2024 für die im Tierarzneimittelgesetz vorgesehenen restriktiven Maßnahmen nutzen wird.
Das Dilemma der Tierärztinnen und Tierärzte
Welche Rolle spezielle, überregional tätige Tierarztpraxen bei der Abgabe von Tierarzneimitteln spielen, ist einer breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. Der Wiederstand innerhalb des tierärztlichen Berufstandes gegen diese Tierarztpraxis, der in der Vergangenheit sehr stark war, ist inzwischen nicht mehr erkennbar. Neben dem Tierarzneimittelgesetz, das im September 2021 inkraft trat und schon 2022 einer Novellierung unterzogen werden musste, ist die Tierärztliche Hausapothekenverordnung ein entscheidendes Instrument zum Umgang und damit zur Kontrolle zur Abgabe von Tierarzneimittel/Antibiotika.
Tierärztinnen und -ärzte führen keine öffentliche Apotheke, sondern dürfen nur Medikamente für ihr Klientel vorrätig halten, anwenden und abgeben. Der Vollzug dieser Verordnung zum sogenannten Dispensierecht – die Apotheken der Tierarztpraxen dürfen Medikamente nur an Tierhalter*innen abgeben, deren Tiere ihnen anvertraut sind – ist von Anfang an ungenügend. So ist es möglich, dass Tierärztinnen und -ärzte Landwirt*innen Medikamente zur Verfügung stellen, obwohl ihr Praxissitz häufig über Hunderte von Kilometern entfernt liegt. Wie unter diesen Bedingungen die vorgeschriebene Wirksamkeit der tierärztlich getroffenen Maßnahmen erfolgen soll, ist für mich schwer vorstellbar.
Hintergrund ist, dass Tierarzneimittel an Veterinärmediziner*innen je nach Abnahmemenge mit hohen Rabatten verkauft werden. Dies führt zu einem massiven Wettbewerbsnachteil für Praxen, die regional arbeiten.
Tierärztliche Standesvertretungen haben mehrfach die Abschaffung von Rabatten gefordert. Im Auftrag der ehemaligen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat die Bosten Consulting Group ein Gutachten erstellt, das zu dem Schluss kommt, dass Rabatte auf Tierarzneimittel keinen Einfluss auf das Handeln der Tierärztinnen und -ärzte hatten.
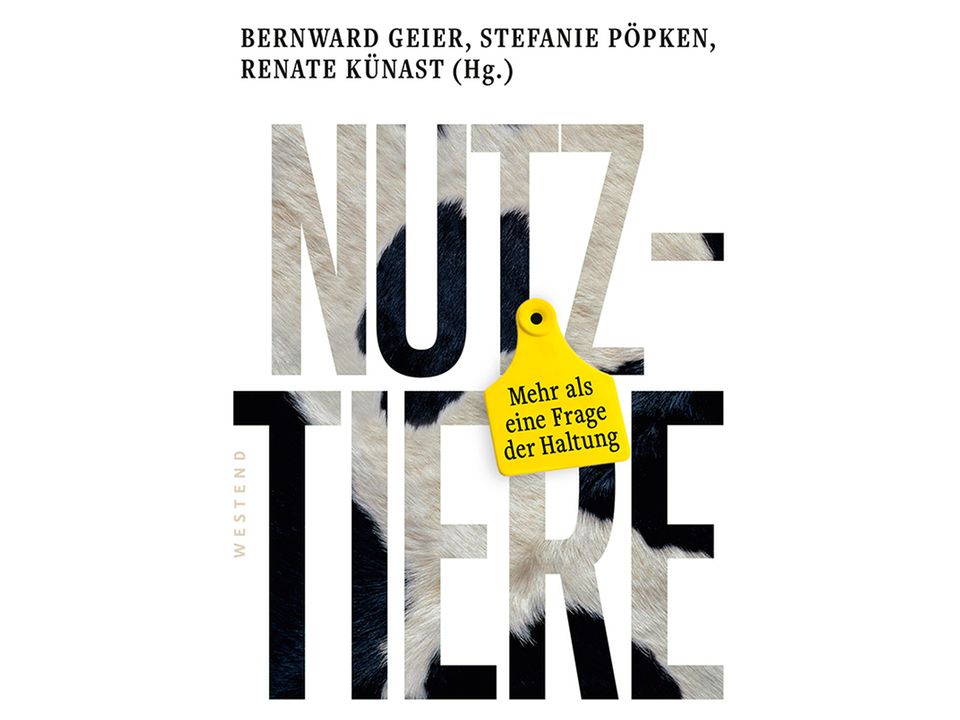
Lesetipp
Der Beitrag ist erschienen in: Bernward Geier, Stefanie Pöpken, Renate Künast: "Nutztiere: Mehr als eine Frage der Haltung", Westend Januar 2023, 264 Seiten, 30 Euro
Als langjähriger tierärztlicher Standesvertreter kann ich da nur den Kopf schütteln. Der Einfluss der Pharmaindustrie und der bäuerlichen Lobbyorganisationen auf die tierärztliche Standespolitik verhindert, dass der Berufsstand der Tierärztinnen und -ärzte sich intensiv für einen verantwortungsvollen Einsatz von Tierarzneimitteln einsetzt, was dazu geführt hat, dass ich unter Protest meine Ehrenämter in den tierärztlichen Organisationen niedergelegt habe. Mein Nachfolger im Amt des Vizepräsidenten, ein höchst honoriger Kollege, hat nach dem Ende seiner Amtszeit aus den gleichen Gründen sogar seinen Beruf gänzlich an den Nagel gehängt und seine Approbation zurückgegeben.
Mein Fazit ist: Industrielle Tierhaltung, mit allen ihren negativen Auswirkungen auf Tierwohl, Umwelt und Klima, ist nur möglich, weil es Tierärztinnen und -ärzte gibt, die das Tierwohl aus den Augen verloren haben und sich Profit getrieben ausschließlich als Lieferant*innen oder als Dienstleister*innen für dieses nach industriellen Prinzipien organsierte System verstehen.





























