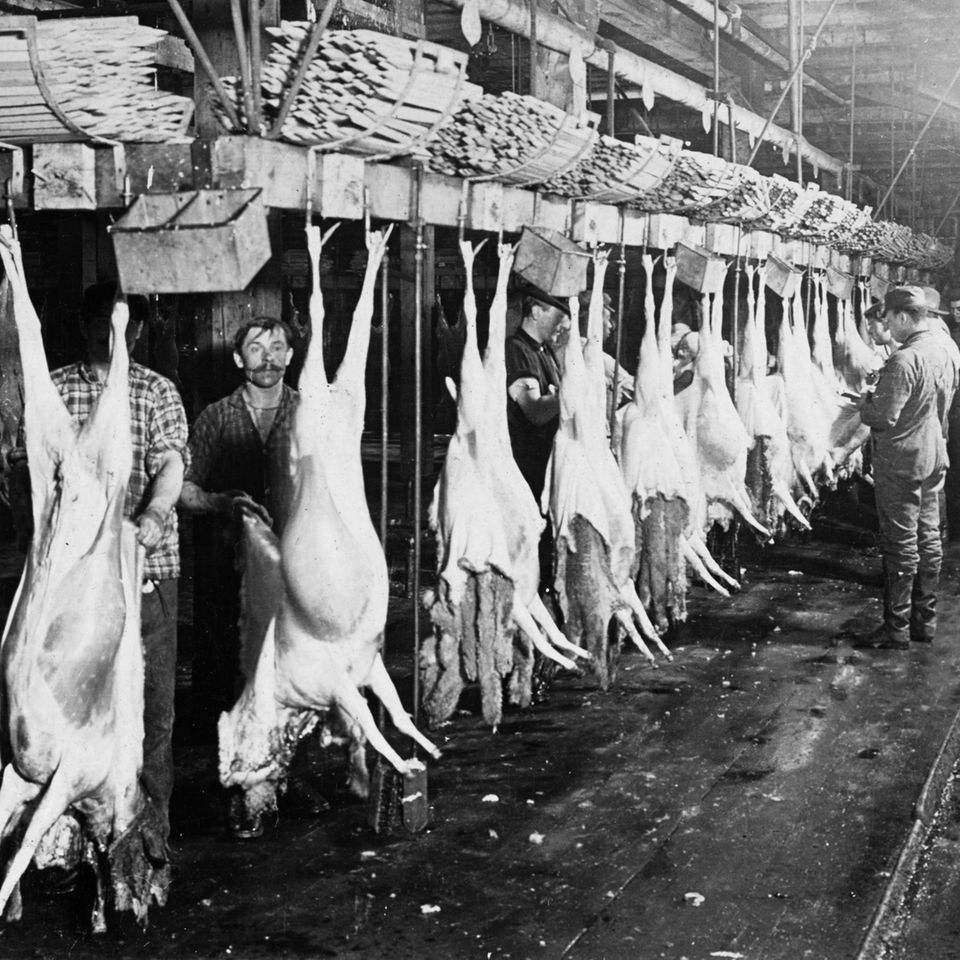Im Handel findet sich auf vielen Fleisch- und Milchverpackungen eine farbige Haltungsform-Kennzeichnung, die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Art und Qualität der Tierhaltung informiert. Seit 2025 unterscheidet dieses System fünf Stufen, die sich deutlich in Platzangebot, Zugang zu Auslauf, Fütterung, Beschäftigungsmöglichkeiten und Tierwohl unterscheiden. Wir erklären die Begrifflichkeiten und geben einen Überblick über die fünf verschiedenen Haltungsformen und deren Vorgaben.
Was verbirgt sich hinter der Haltungsform-Kennzeichnung?
Die farbige Haltungsform-Kennzeichnung, die von der Initiative Tierwohl verantwortet wird, ist ein freiwilliges Label, das seit 2019 nur bei teilnehmenden Händlern auf den Verpackungen von Fleisch- und Milchprodukten zu finden ist. Die Initiative setzt sich für höhere Standards in der Nutztierhaltung ein und definiert klare Kriterien, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Dazu zählen eine tiergerechtere Stallgestaltung, zusätzliche Beschäftigungsangebote sowie regelmäßige Gesundheitskontrollen durch unabhängige Prüfinstanzen.
Zunächst kennzeichnete das Label hauptsächlich das Fleisch von Schweinen, Rindern, Hühnern und Puten. Seit 2021 können auch Kaninchen, Peking-Enten sowie Milch und Milchprodukte mit der "Haltungsform" gekennzeichnet werden. Das Label selbst ist kein Tierwohlprogramm, sondern informiert über die Herkunft des im Supermarkt angebotenen Produkts sowie Haltungsbedingungen und Kontrollmechanismen. Es dient also als schnelle Orientierungshilfe.
Im Spätsommer 2025 soll außerdem ein weiteres schwarz-weißes Logo hinzukommen – das staatliche Tierhaltungskennzeichen "Tierhaltung". Die Kennzeichnung wird zunächst für alle frischen Schweinefleischprodukte, die in Deutschland produziert worden sind, verpflichtend sein in allen Verkaufsstellen. Lebensmittel aus dem Ausland können freiwillig gekennzeichnet werden.
Haltungsform 1: Stallhaltung (Mindeststandard)
Die "Haltungsform 1" stellt die niedrigste Stufe der Kennzeichnung dar. Sie entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandards in Deutschland und der am weitesten verbreiteten Form der Nutztierhaltung. Die Tiere werden ausschließlich in geschlossenen Ställen untergebracht, meist ohne Zugang zu Frischluft und ohne Tageslicht. Das Platzangebot umfasst die gesetzlichen Mindestvorgaben. Die Fütterung erfolgt mit konventionellen Futtermitteln, die den Grundbedarf der Tiere decken. Um die Einhaltung dieser Anforderungen sicherzustellen, finden regelmäßige Kontrollen auf Grundlage der gesetzlichen Standards statt.

Haltungsform 1 im Überblick
| Kriterium | Haltungsform 1 |
| Platz pro Mastschwein | 0,75 m² |
| Platz pro Jungbulle | 3 m² |
| Platz pro Masthuhn | bis zu 39 kg/m² |
| Beschäftigung | Mindestanforderung (Stroh, Holz, einfache Materialien) |
| Fütterung | konventionelles Futter (Soja, Getreide) |
| Zugang zu Außenklima | kein Zugang |
| Kontrollen | gesetzliche Mindeststandards |
Haltungsform 2: Stallhaltung Plus
Die zweite Haltungsstufe nennt sich "Stallhaltung Plus". Diese geht über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus. Die Tiere verfügen über bis zu zehn Prozent mehr Platz als bei Haltungsform 1, und Kühe dürfen nicht angebunden sein. Zwar haben die Tiere keinen Frischluftzugang, aber zumindest sorgt gezielter Einfall von Tageslicht für eine natürlichere Umgebung. Dazu stehen den Tieren zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung, und die Fütterung ist hochwertiger. Schweine erhalten zusätzlich Raufutter wie Stroh oder Heu, was ihr natürliches Wühlverhalten unterstützt und zur Beschäftigung beiträgt. Auch Fressgitter kommen zum Einsatz, um eine gleichmäßige Futterverteilung zu gewährleisten.
Haltungsform 2 im Überblick
| Kriterium | Haltungsform 2 |
| Platz pro Mastschwein | 0,83 m² |
| Platz pro Jungbulle | 3,3 m² |
| Platz pro Masthuhn | bis zu 35 kg/m² |
| Beschäftigung | mehr Beschäftigungsmaterial (Stroh oder Picksteine) |
| Fütterung | hochwertige Futtermischung |
| Zugang zu Außenklima | kein Zugang |
| Kontrollen | zusätzliche Kontrollen über gesetzlichen Mindeststandards |
Haltungsform 3: Außenklima
Bei Haltungsform 3 haben die Tiere Kontakt zum Außenklima, beispielsweise über eine offene Stallseite oder einen teilüberdachten Außenbereich. Zudem haben die Tiere – außer Enten – noch mehr Platz im Stall (Beispiel Schwein: plus 40 Prozent). Für die Fütterung sind hochwertige, häufig regionale Futtermittel ohne Gentechnik vorgeschrieben. Außerdem wird die Gesundheit der Tiere intensiver überwacht – regelmäßige Gesundheitschecks sind Pflicht.
| Kriterium | Haltungsform 3 |
| Platz pro Mastschwein | 1,05 m² |
| Platz pro Jungbulle | 4,2 m² |
| Platz pro Masthuhn | bis zu 25 kg/m² |
| Beschäftigung | erweiterte Beschäftungsmöglichkeiten (z. B. zusätzliche Wühlmaterialien) |
| Fütterung | hochwertiges Futter ohne Gentechnik, oft regional |
| Zugang zu Außenklima | Zugang zu Außenklimabereichen |
| Kontrollen | zusätzliche Gesundheitschecks |
Haltungsform 4: ehemals "Premium", künftig "Auslauf/Weide"
Die neue Haltungsform 4 "Auslauf/Weide" ersetzt die bisherige Haltungsform "Premium". Diese Stufe steht für höhere Anforderungen an das Tierwohl und geht deutlich über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinaus. Die Tiere verfügen über mindestens doppelt so viel Platz wie vorgeschrieben und haben jederzeit Zugang zu Außenklimabereichen – etwa überdachten Ausläufen, Weideflächen oder offenen Stallbereichen mit Frischluftzufuhr. Typisch für Haltungsform 4 sind vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten sowie klar strukturierte Stallbereiche, die den Tieren Abwechslung, Orientierung und Rückzugsräume bieten. Die Fütterung erfolgt mit hochwertigem Futter aus konventioneller, oftmals aber nachhaltiger Landwirtschaft. Ziel dieser Haltungsform ist es, Tierwohlstandards auch innerhalb der konventionellen Tierhaltung transparent und nachvollziehbar umzusetzen.
| Kriterium | Haltungsform 4 |
| Platz pro Mastschwein | bis 150 kg mind. 1,5 m² |
| Platz pro Jungbulle | 5 m², aber mindestens 1 m²/100 kg |
| Platz pro Masthuhn | bis zu 21 kg/m² |
| Beschäftigung | vielfältige Beschäftungsmöglichkeiten (Wühlmaterialien, Scharrgut, Strom, Raufutter) |
| Fütterung | hochwertige Futtermittel ohne Gentechnik, mind. 60 % regionale Futtermittel |
| Zugang zu Außenklima | Weide- oder Freilaufhaltung |
| Kontrollen | zusätzliche Gesundheitschecks, erweiterte Kontrollen |
Haltungsform 5: Bio (neu ab 2025)
Zunehmend finden sich Produkte in den Supermarktregalen mit dem Haltungsform-Label "5 Bio". Es kennzeichnet ökologisch erzeugte Produkte, die bislang unter der Haltungsform 4 "Premium" einsortiert waren. Voraussichtlich bis zum zweiten Halbjahr 2025 soll die fünfstufige Kennzeichnung die vierstufige komplett ablösen. Die Tiere verfügen über deutlich mehr Platz, ganzjährigen Zugang zu Auslauf- oder Weideflächen sowie über Rückzugs- und Beschäftigungsangebote im Stall. Gefüttert wird ausschließlich mit Bio-Futter, in der Regel aus kontrolliert biologischem Anbau. Darüber hinaus gelten strenge Vorgaben: Der Einsatz von Gentechnik ist untersagt, Antibiotika sind stark reglementiert und nicht zwingend notwendige Eingriffe verboten.
| Kriterium | Haltungsform 5 |
| Platz pro Mastschwein | bis 110 kg mind. 1,3 m² im Stall und 1 m² Auslauffläche |
| Platz pro Jungbulle | 6 m² |
| Platz pro Masthuhn | bis zu 21 kg/m², aber mind. 1 m²/100 kg |
| Beschäftigung | vielfältige Beschäftungsmaterialien (Wühlmaterialien, Scharrgut, Strom, Raufutter) |
| Fütterung | ausschließlich Futtermittel ohne Gentechnik aus ökologischer Erzeugung |
| Zugang zu Außenklima | Laufstallhaltung mit Auslauf oder Weide |
| Kontrollen | erweiterte Kontrollen |
Kritik an der Haltungsform-Kennzeichnung
Die Haltungsform-Kennzeichnung soll mehr Transparenz beim Fleischkauf bieten. Doch zahlreiche Tierschutzorganisationen, Verbraucherschützer und Experten äußern Kritik an diesem System. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Ein zentraler Kritikpunkt ist die geringe Aussagekraft der unteren Stufen: Die Haltungsformen 1 ("Stallhaltung") und 2 ("Stallhaltung Plus") entsprechen lediglich dem gesetzlichen Mindeststandard oder gehen nur minimal darüber hinaus. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher nehmen das Label dennoch als Qualitätsmerkmal wahr, obwohl insbesondere Stufe 1 keine Verbesserung für das Tierwohl bedeutet.
Ein weiteres Problem ist die fehlende Verbindlichkeit der Kennzeichnung. Sie ist bislang freiwillig und findet sich daher nicht auf allen Produkten – insbesondere nicht an Frischetheken, in der Gastronomie oder bei verarbeiteten Fleischwaren wie Wurst. Auch importiertes Fleisch sowie viele andere tierische Produkte wie Milch und Eier sind in der Regel nicht gekennzeichnet. Zudem gilt die Kennzeichnungspflicht bisher nur für in Deutschland produziertes, unverarbeitetes Schweinefleisch im Einzelhandel. Geflügel, Rindfleisch und verarbeitete Produkte sind bislang weitgehend ausgenommen. Das führt zu einem unübersichtlichen Nebeneinander verschiedener Siegel, für Verbraucher oft verwirrend.
Kritisiert wird außerdem, die Unterschiede zwischen den einzelnen Stufen seien häufig nicht groß genug, um einen echten Fortschritt beim Tierschutz zu erzielen. So bietet beispielsweise Stufe 2 nur rund zehn Prozent mehr Platz als das gesetzliche Minimum – aus Sicht vieler Tierschützer ist das weiterhin nicht ausreichend. Hinzu kommt, dass sich die Kennzeichnung meist nur auf die Mastphase bezieht, nicht aber auf andere wichtige Bereiche wie Aufzucht, Transport oder Schlachtung. Gerade dabei finden jedoch viele tierschutzrelevante Eingriffe statt.
Ein weiteres Problem ist die Gefahr von Missverständnissen: Viele Menschen verstehen die Begriffe und Stufen nicht richtig oder schätzen die Unterschiede zwischen den Haltungsformen falsch ein. Die Bezeichnungen klingen oft positiver, als die tatsächlichen Bedingungen es rechtfertigen. Auch die Kontrolle der Kriterien erfolgt nicht immer durch staatliche Stellen, sondern häufig durch private Unternehmen, was die Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit erschwert.
Nicht zuletzt werden wichtige Aspekte wie Qualzucht, Spaltenböden, Gruppengrößen oder das Kupieren von Schwänzen bei der Kennzeichnung kaum berücksichtigt. Insgesamt bleibt die Haltungsform-Kennzeichnung damit in vielen Punkten hinter den Erwartungen zurück. Für echten Tierschutz fordern viele Experten eine verpflichtende, umfassende und staatlich kontrollierte Kennzeichnung aller tierischen Produkte und für alle Phasen der Tierhaltung.