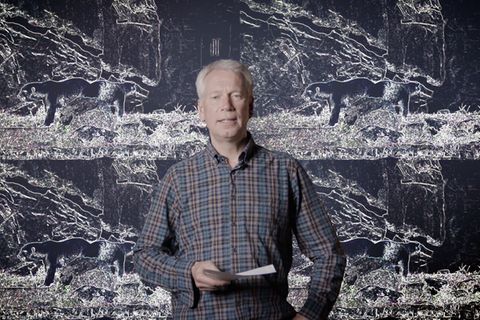Die Vogelgrippe grassiert in Deutschland, und in den Nachrichten ist viel von betroffenen Geflügelzüchtern und -züchterinnen zu hören, von geschädigten Legehennen- und Mastbetrieben, von Ausfällen, Entschädigungssummen, Vermarktungslücken. Fachleute rekonstruieren Übertragungswege und Krankheitsverläufe, verfolgen die Ausbreitung des Virus. Konsumentinnen und Konsumenten fragen sich besorgt: Werden die Martinsgänse nun teurer? Explodieren die Eierpreise?
Geradezu gespenstisch ist in der aktuellen Nachrichtenflut die Abwesenheit von Empathie. Da werden Hunderttausende von fühlenden Lebewesen "gekeult", weil es in einem Stall einen Verdachtsfall gibt, werden in mobilen Anlagen durch "elektrische Ganzkörper-Durchströmung" getötet oder in Containern mit Kohlendioxid erstickt. Unter hohem Zeitdruck. Stress, Todesangst, Gewalt und Knochenbrüche inklusive. Als wäre das alternativlos.
Als wäre es irgendwie in Ordnung, Tiere, die nicht infiziert sind oder keine Symptome zeigen, "vorsorglich" zu töten.
Es stimmt zwar: Das Keulen im Seuchenfall ist von geltendem Recht gedeckt und aus veterinärmedizinischer Sicht auch geboten. Der "vernünftige Grund", den das Tierschutzgesetz für das Töten von Tieren fordert, liegt darin, Schaden für Mensch und Tier abzuwenden, eine Ausbreitung des Virus auf weitere Bestände zu verhindern.
Der "vernünftige Grund" und das Recht auf Leben
Doch so nachvollziehbar das ist: Wer das "vorsorgliche" Töten von gesunden Tieren bejaht, veranschlagt bei der Abwägung der Interessen von Tieren, Tierhaltenden und Seuchenschutz das Recht des Tieres auf Leben, seinen Willen, am Leben zu bleiben: mit null.
Und das ist nun weder selbstverständlich noch zeitgemäß. Und es entspricht auch nicht dem Trend in der Rechtsprechung, die (individuellen) Rechte von Tieren stärker zu gewichten. So entschied schon vor sechs Jahren das Bundesverwaltungsgericht: Das Interesse der Eierindustrie und der Brütereien, Geld zu verdienen, darf nicht über das Recht der Küken auf Leben gestellt werden. Das Verbot des lange praktizierten Kükenschredderns war die Folge.
Der Ausbruch von H5N1 in deutschen Ställen zeigt schlaglichtartig die Schattenseite einer radikal durchökonomisierten Tierproduktion. Und legt eine Lösung nahe, die bei der Ursache ansetzt: Die Tierzahlen müssen runter – in den einzelnen Ställen ebenso wie in den Ländern und Regionen. Es ist kein Zufall, dass der niedersächsische Landkreis Cloppenburg von der Vogelgrippe besonders betroffen ist. Auf jeden Quadratkilometer kommen hier 13.000 Hühner, Gänse und Puten.