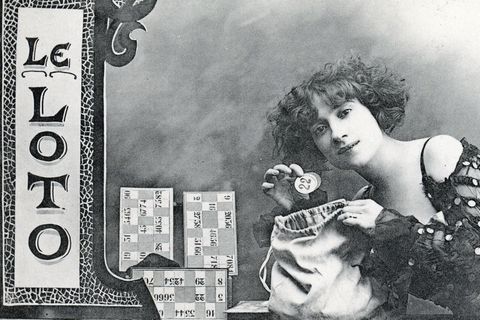Ein Mob zieht im März 1623 durch Biberach in Oberschwaben. Die Menschen sind hungrig und wütend, weil die Preise für das tägliche Leben immer weiter steigen: Ein Pfund Käse kostet sechsmal so viel wie vor fünf Jahren, der Preis für Roggen hat sich versiebenfacht, für Hafer sogar verachtfacht. Ziel der aufgebrachten Städter ist das Haus des Getreidehändlers Simon Zell. Korn soll er angeblich horten und die Preise treiben.
Die Leute stürmen das Gebäude, schlagen Zells Frau, reißen Schubladen auf und nehmen mit, was sie finden. Der Kaufmann klagt später beim Stadtrat, die Eindringlinge hätten ihn "geschelmet und gediebet". Der Angriff ist Ausdruck einer beispiellosen Geldkrise im Heiligen Römischen Reich. Kleine Münzen wie Batzen, Groschen und Schillinge, Kreuzer, Pfennige und Heller sollten eigentlich silbern glänzen.
Doch nun schimmert billiges Kupfer durch. Händler verlangen Aufschläge, wenn jemand mit Kleingeld bezahlt. Im ganzen Reich verliert das Geld an Kaufkraft. Zeitgenossen nennen das Phänomen "Münzverderbnis" oder die "Zeit faulen Geldes". Heute kennen wir es vor allem unter dem lateinischen Begriff für Aufblähung: Inflation.