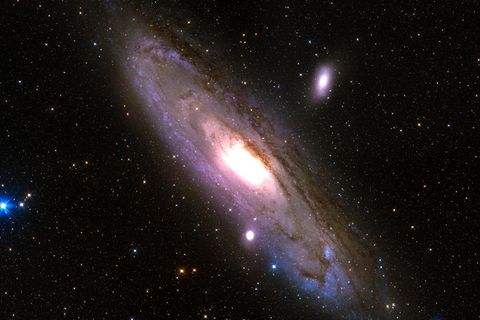Der (astronomische) Sommer steht kurz bevor. In den Wochen vor dem Jahreszeitenwechsel nähert sich die Mittagshöhe der Sonne langsam ihrem Höhepunkt, werden die Tage stetig etwas länger. Am 21. Juni um 4:42 Uhr erreicht die Sonne schließlich den Gipfel ihrer Jahresbahn, es kommt zur Sommersonnenwende. Wir erleben den längsten Tag des Jahres, nun beginnt bei uns auf der Nordhalbkugel offiziell der Sommer.
Die Sommernächte sind nicht nur kurz, sondern auch vergleichsweise hell, vor allem im Norden. Entsprechend eingeschränkt sind die Bedingungen, um den Sternenhimmel zu beobachten. Wer es dennoch probiert, wird vom hübschen Anblick des Sommerdreiecks belohnt, das sich aus der bläulich-weißen Wega in der Leier, Atair im Adler und Deneb im Schwan zusammensetzt.
Faszination Milchstraße: Die besten Aufnahmen des Jahres

Faszination Milchstraße: Die besten Aufnahmen des Jahres
Das Sternbild Schwan wird auch als "Kreuz des Nordens" bezeichnet und ist das wohl schönste hiesige Sommersternbild. Auch Antares im Skorpion funkelt rötlich über dem Horizont. Er ist ein wahrer Blickfang, leider kommen wir hierzulande nie in den Genuss des kompletten Skorpions. Wer im Mittelmeerraum Urlaub macht, sollte einen Blick zum Himmel werfen: Denn weiter im Süden können wir auch die malerisch geschwungene Sternenkette betrachten, die den hinteren Teil des Skorpions darstellt.
Eine Nacht wird erst dann richtig dunkel, wenn die Sonne tiefer als 18 Grad unter den Horizont sinkt. In weiten Teilen Deutschlands steht unser Tagesgestirn in den Sommermonaten aber deutlich höher. In Hamburg sind es beispielsweise nur etwa 12 bis 13 Grad. Daher bleibt das Streulicht der Sonne in der Atmosphäre sichtbar, die Abenddämmerung geht förmlich in die Morgendämmerung über. Wir sprechen von der "Mitternachtsdämmerung". Ein silbrig blauer Streifen über dem Horizont verrät, wo sich die Sonne unter dem Horizont befindet. In den Regionen nördlich des 54. Breitenkreises, am norwegischen Nordkap, leuchtet die Sonne sogar um Mitternacht noch über dem Nordhorizont.

Rund um die Sommersonnenwende können wir das Naturschauspiel der leuchtenden Nachtwolken (englisch "Noctilucent Clouds") beobachten. Sie unterscheiden sich wesentlich von den Wolken, die wir üblicherweise beobachten.
Normale Wolken entstehen, wenn Wasser am Boden verdunstet, zu Wasserdampf wird und in den Himmel aufsteigt. In der Troposphäre, einer niedrigen Schicht der Erdatmosphäre bis etwa zwölf Kilometer Höhe, treffen die Wassertröpfchen auf kleinste Ruß- und Staubpartikel. An ihnen kondensiert der Wasserdampf. Ohne die für uns unsichtbaren Teilchen könnten sich keine Wolken bilden.
Die hübschen leuchtenden Nachtwolken, die wir noch bis in den Juli hinein tief am Nord-Horizont sehen, haben mit den gewöhnlichen Wolken nichts zu tun. Sie bilden sich in der Mesopause ab etwa 80 Kilometern Höhe.

Es ist die kälteste Schicht der Erdatmosphäre, in der auch kosmische Staubteilchen zu Sternschnuppen verglühen. Dieser kosmische Staub dient wohl als Kristallisationskeim, an dem sich Wasser zu Wassereis wandelt.
Die nachtleuchtenten Wolken unterscheiden sich also auf gleich dreifache Weise von normalen Wolken: Sie entstehen in wesentlich höheren Schichten, sie entstehen an außerirdischem Material und sie bestehen statt aus flüssigem Wasser aus Eis.
Um die geringe Wasserdampfkonzentration in der Mesopause zum Gefrieren zu bringen, muss es dort mindestens minus 140 Grad Celsius kalt sein. Und um sie sehen zu können, muss die Sonne richtig stehen. Das ist zwischen Mitte Mai und Mitte August der Fall. Zu dieser Zeit hat die Sonne nachts die optimale Position unter dem Horizont, um die Wolken in der Mesopause trotz der dämmrigen Lichtverhältnisse zum Leuchten zu bringen. Denn dafür darf unser Tagesgestirn nur 6 bis 16 Grad unter den Horizont sinken. Im Norden sind die Sichtbedingungen daher ideal, weiter südlich sind die Möglichkeiten aufgrund der tieferstehenden Sonne eingeschränkter.