Seit Jahrzehnten gehört das Dehnen zum Sport wie das Warmlaufen. Viele Sportlerinnen und Sportler beginnen oder beenden ihr Training mit ausgiebigen Stretching-Ritualen – in der Hoffnung, damit Verletzungen vorzubeugen, Muskelkater zu lindern oder die Haltung zu verbessern. Doch was davon stimmt wirklich? Und was passiert im Körper, wenn wir uns dehnen?
Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Jan Wilke, Professor für Neuromotorik und Bewegung an den Universitäten Bayreuth und Klagenfurt, hat nun erstmals wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für die Praxis formuliert. 20 der weltweit führenden Expertinnen und Experten sichteten die aktuelle Studienlage und einigten sich in einem mehrstufigen Konsensverfahren ("Delphi-Verfahren") auf klare Leitlinien. Das Ergebnis: Dehnen ist nützlich – aber längst nicht in allen Fällen.
Warum wir so gern dehnen – und was davon stimmt
Die Erwartungen an das Stretching sind hoch: höhere Beweglichkeit, weniger Schmerzen, bessere Haltung, weniger Verletzungen. Doch viele dieser Versprechen sind wissenschaftlich nicht haltbar.
- Muskelkater lässt sich durch Dehnen nicht verhindern – im Gegenteil: Wer nach intensiver Belastung lange zieht und streckt, kann die kleinen Mikroverletzungen in den Muskelfasern sogar verstärken.
- Auch zur Haltungsverbesserung taugt Stretching nicht. Ein Rundrücken etwa bessert sich nicht durch das Dehnen der Brustmuskulatur, sondern durch gezieltes Krafttraining der Rückenmuskeln.
- Und selbst als Mittel zur Verletzungsprophylaxe wird Dehnen überschätzt: Der Effekt ist, wenn überhaupt vorhanden, sehr gering und steht in keinem Verhältnis zur aufgewendeten Zeit.
Was bedeutet eigentlich Steifigkeit?
Viele Menschen klagen über "steife" Muskeln oder Gelenke. Doch Steifigkeit meint nicht, dass der Muskel physisch kürzer oder härter wäre. Beim Dehnen verändert sich zweierlei:
- Zum einen lässt sich die Spannung im Muskel- und Bindegewebe verringern.
- Zum anderen verschiebt sich die Schmerzschwelle: Das Nervensystem erlaubt plötzlich einen größeren Bewegungsradius, ohne dass es zieht.
Wichtig zu wissen: Sehnen bleiben durch Stretching unverändert, ihre Steifigkeit bleibt gleich hoch. Bänder dagegen sollten überhaupt nicht gedehnt werden – sie stabilisieren die Gelenke, und eine Überdehnung kann schaden.
Was beim Dehnen im Körper passiert
Ein verbreiteter Mythos lautet: Wer regelmäßig dehnt, verlängert durch bestimmte Übungen seine Muskeln dauerhaft. Doch das stimmt nicht. Muskeln ziehen sich nach dem Stretching wieder in ihre Ausgangslänge zurück. Die empfundene Beweglichkeitssteigerung beruht vor allem auf einer Anpassung des Nervensystems und einer veränderten Schmerztoleranz.
Darum gilt: Dehnen kann zwar kurzfristig die Beweglichkeit erhöhen. Aber diese Übungen machen die Muskeln nicht "länger" – und ersetzt auch kein gezieltes Training. Kraftübungen, die über den vollen Bewegungsradius ausgeführt werden, verbessern die Flexibilität oft ebenso wirksam wie Stretching.
Wann eine Dehnung wenig bringt – oder sogar schadet
Nicht nur ineffektiv, sondern teilweise auch kontraproduktiv ist Dehnen in bestimmten Situationen:
- Direkt vor Schnellkraftleistungen wie Sprint oder Weitsprung kann langes statisches Stretching die Maximalkraft vorübergehend reduzieren. Das ist der Grund, weshalb Profisportler vor Wettkämpfen heute eher auf dynamisches Aufwärmen setzen.
- Auch nach dem Training hat Dehnen keine regenerative Wirkung. Für die Erholung sind leichte Bewegung, lockeres Auslaufen oder Kälteanwendungen deutlich effektiver.
Wann und wie Dehnen sinnvoll ist
Trotz dieser Einschränkungen bleibt Stretching ein wertvolles Werkzeug – wenn die Dehnung gezielt eingesetzt wird:
- Für Sportarten mit hoher Beweglichkeitsanforderung wie Turnen, Ballett oder Kampfsport ist Dehnen unverzichtbar.
- Bei akuten Verspannungen oder muskulärer Steifigkeit (etwa im Nacken oder in den Waden) kann Stretching helfen, Schmerzen zu lindern.
- Und selbst im Bereich der Herz-Kreislauf-Gesundheit zeigen sich positive Effekte: Regelmäßiges statisches Dehnen kann die Elastizität der Blutgefäße verbessern, den Blutdruck leicht senken und die Herzfrequenz reduzieren.
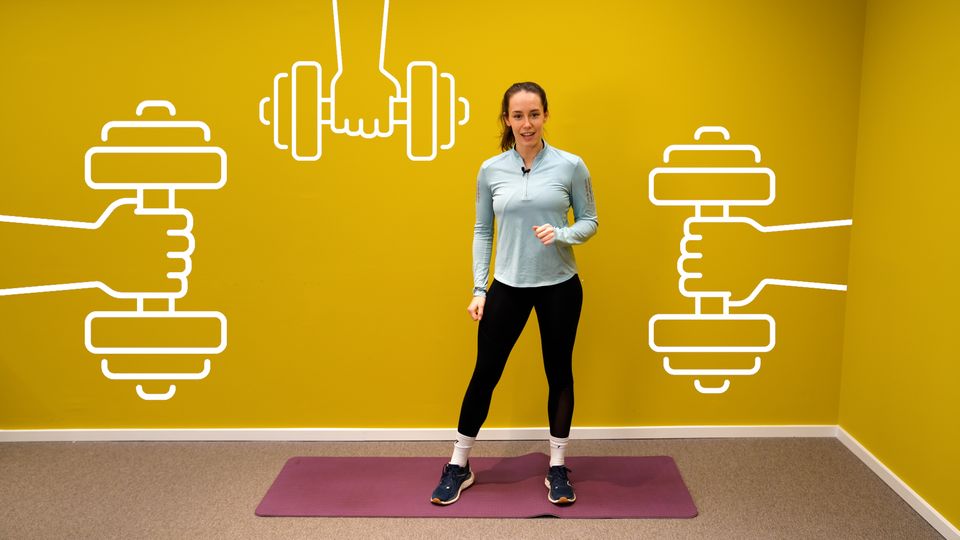
Die neuen Empfehlungen im Überblick
Das internationale Expertenteam hat die aktuelle Studienlage systematisch ausgewertet – und daraus erstmals klare Regeln für die Praxis formuliert. Diese Empfehlungen unterscheiden sich nach Zielsetzung:
1. Beweglichkeit steigern
Wer kurzfristig beweglicher sein möchte – etwa, um beim Yoga tiefer in eine Position zu kommen oder beim Sport den Bewegungsradius zu erweitern –, sollte zwei Serien mit Dehnübungen von jeweils 5 bis 30 Sekunden durchführen. Ob statisch, dynamisch oder mit kleinen federnden Bewegungen, spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist die Wiederholung.
2. Muskelsteifigkeit reduzieren
Bei spürbaren Verspannungen, beispielsweise in den Waden nach einem Lauf oder im Nacken nach langem Sitzen, reicht kurzes Dehnen nicht aus. Hier empfehlen die Fachleute mindestens vier Minuten statisches Dehnen, verteilt auf eine oder mehrere Übungen. Für einen nachhaltigen Effekt sollte diese Routine fünfmal pro Woche erfolgen. Eine gewisse Regelmäßigkeit ist also nötig, um die Spannung im Gewebe tatsächlich zu senken.
3. Herz-Kreislauf-System unterstützen
Noch wenig bekannt ist der Einfluss von Dehnübungen auf die Gefäßgesundheit. Studien deuten darauf hin, dass längeres Stretching die Elastizität der Arterien verbessert, den Blutdruck leicht senken und die Herzfrequenz reduzieren kann. Dafür sind allerdings längere Einheiten nötig: mindestens sieben Minuten statisches Dehnen für akute Effekte – oder 15 Minuten mehrmals wöchentlich, um langfristig davon zu profitieren. Besonders für ältere Menschen oder Personen mit Bluthochdruck könnte dies ein ergänzendes Mittel zur Gesundheitsvorsorge sein.
Nicht empfohlen wird Stretching hingegen für:
- Verletzungsprophylaxe: Der Effekt ist minimal und rechtfertigt den Aufwand nicht.
- Regeneration nach dem Sport: Muskelkater lässt sich durch Dehnen nicht verhindern oder lindern.
- Haltungsverbesserung: Fehlhaltungen wie Rundrücken bessern sich nur durch gezieltes Krafttraining, nicht durch Stretching.
Die neuen Leitlinien machen deutlich: Dehnen ist kein Allheilmittel, sondern ein Werkzeug mit spezifischen Einsatzfeldern. Es kann Beweglichkeit verbessern, Steifigkeit lindern und das Herz-Kreislauf-System unterstützen – aber nur, wenn es gezielt und regelmäßig angewandt wird. Für Freizeitsportler bedeutet das: Wer Freude am Stretching hat, darf es beibehalten. Aber es lohnt sich, bewusst zu überlegen, wann und warum man dehnt. Denn nicht jedes Ziehen und Strecken erfüllt auch seinen Zweck.




























