Bürojobs sind eine Gefahr für die Gesundheit, da sind sich Forschende einig. Die Nachteile des langen Sitzens umfassen Rückenbeschwerden, schwächelnde Knochen, Übergewicht, Diabetes, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sogar das Risiko für manche Krebsarten steigt. Auf dem Schreibtischstuhl rollen wir reglos einem frühen Tod entgegen – es sei denn, wir treiben in unserer Freizeit ausreichend Sport.
Wer hingegen körperlich arbeitet, so sollte man meinen, genießt die Vorzüge eines aktiven Lebensstils bereits im Job. Doch die Daten zeichnen ein anderes Bild. Während Bewegung in der Freizeit unsere Gesundheit auf vielerlei Weise fördert, macht sie während der Arbeitszeit oft krank. Handwerkerinnen, Pflegekräfte oder Kellner sind nicht automatisch fitter als Sachbearbeiter oder Programmiererinnen. Im Gegenteil: Bei Männern steigert ein körperlich anstrengender Beruf die Wahrscheinlichkeit eines frühzeitigen Todes um 18 Prozent. Menschen, die den ganzen Tag stehen, erkranken doppelt so häufig an Herz-Kreislauf-Leiden wie die vermeintlich so gefährdeten Vielsitzer. Forschende sprechen vom "Paradox der körperlichen Aktivität". Oft geht es zulasten von Menschen, die für ihre Arbeit bereits schlecht bezahlt werden: Gerade Jobs in der Pflege und der Kinderbetreuung, im Einzelhandel und im Baugewerbe, in der Produktion und der Gastronomie gehen mit physischer Anstrengung einher.
Finanzielle Sorgen, prekäre Lebensumstände und ein chronisch hohes Stresslevel schaden der körperlichen und psychischen Gesundheit genau wie mangelnde Kontrolle über die eigenen Arbeitsabläufe. Und nach einem harten Tag fehlt womöglich die Kraft, einen Sportkurs zu besuchen oder sich eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Doch das Paradox besteht auch dann weiter, wenn derlei negative Einflüsse mithilfe statistischer Methoden aus den Daten herausgerechnet werden. "Zahlreiche epidemiologische Studien belegen, dass eine hohe körperliche Aktivität im Beruf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Mortalität erhöht, selbst nach umfangreichen Anpassungen hinsichtlich anderer Risikofaktoren wie sozioökonomischem Status, körperlicher Aktivität in der Freizeit und anderen gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen", schreiben Forschende um Andreas Holtermann von der Universität Kopenhagen im "British Journal of Sports Medicine".
Fachleute vermuten, dass Art und Dauer der Bewegungen den Unterschied machen. Treiben wir Sport, strengen wir uns für kurze Zeit intensiv an, um danach zu regenerieren. Wir wählen meist abwechslungsreiche Bewegungsabläufe und vermeiden Übungen, die uns Schmerzen verursachen. All das ist im Arbeitskontext nicht möglich. "In vielen Berufen erfordert die Arbeit, dass man mehrere Tage hintereinander sieben bis zwölf Stunden pro Tag körperlich aktiv ist, wobei die Häufigkeit und Dauer der Ruhepausen innerhalb und zwischen den Arbeitstagen begrenzt sind", resümiert Holtermann. "In der Sportmedizin würde das als Übertraining angesehen werden." Hinzu kommen statische Belastungen, das Heben schwerer Gegenstände, sich ständig wiederholende und unnatürliche Bewegungsabläufe und Körperhaltungen. Das führt nicht nur zu Verspannungen und Verschleißerscheinungen, sondern unter Umständen auch zu dauerhaft erhöhtem Blutdruck und Entzündungen.
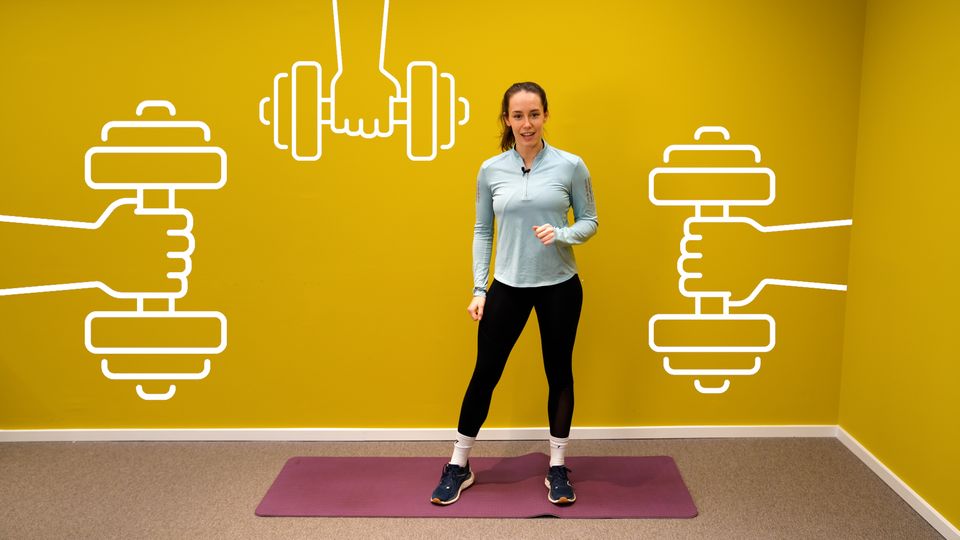
Hilft es Menschen mit körperlich anstrengenden Jobs, sich auch in der Freizeit zu bewegen? Oder schadet das ihrem überlasteten Körper sogar? Eine klare Antwort darauf steht noch aus. Eine Auswertung mehrerer Studien aus dem Jahr 2021 legt nahe, dass vor allem solche Menschen von sportlichen Aktivitäten profitieren, die sich im Beruf weniger stark verausgaben. "Für verschiedene Berufsgruppen könnten maßgeschneiderte Interventionen erforderlich sein", schreiben die Autor*innen, schränken aber ein: "Aufgrund der relativ geringen Anzahl an Studien und der geringen bis sehr geringen Evidenzstärke lassen sich keine eindeutigen Aussagen treffen."
Einen Mangel an qualitativ hochwertigen Daten beklagen auch Genevieve Dunton und Britni Belcher von der University of Southern California in einem aktuellen Beitrag im "British Journal of Sports Medicine". Oft werde die Rolle von Schlaf und Ruhephasen nicht ausreichend beachtet; außerdem unterschieden Studien selten zwischen Jobkategorien. Wer den ganzen Tag hinter der Ladentheke steht, ist anderen Belastungen ausgesetzt als jemand, der Böden schrubbt, Wände mauert oder alte Leute aus dem Bett in die Dusche hievt.
Die Autorinnen wollen diesem Problem unter anderem mithilfe von Sensordaten beikommen. Viele Fitnesstracker und Smart Watches messen neben Bewegungsdaten auch Herzfrequenz, Blutdruck und Schlafqualität. Eine Smartphone-App könnte ergänzend Details zu den Bewegungen im Alltag abfragen – möglichst zeitnah, bevor die Erinnerung das Erlebte verzerrt. Sie argumentieren, nur mittels solcher engmaschig erhobener Daten lasse sich das Bewegungsparadox vollständig aufklären.
Doch selbst wenn die Antwort gefunden ist, bleibt die Ungerechtigkeit bestehen. Viele Menschen, die am Rechner arbeiten, können Dehnübungen in ihren Alltag einstreuen, zwischen Meetings Treppen steigen oder in der Mittagspause eine Runde joggen gehen. In körperlich fordernden Jobs mit hohem Pensum ist ein solcher Ausgleich nicht ohne Weiteres möglich. Sitzen ist vielleicht "fürn Arsch", wie ein Buchtitel verkündet. Aber zumindest kann man dabei selbst beeinflussen, wie oft man den Hintern hochkriegt.






























