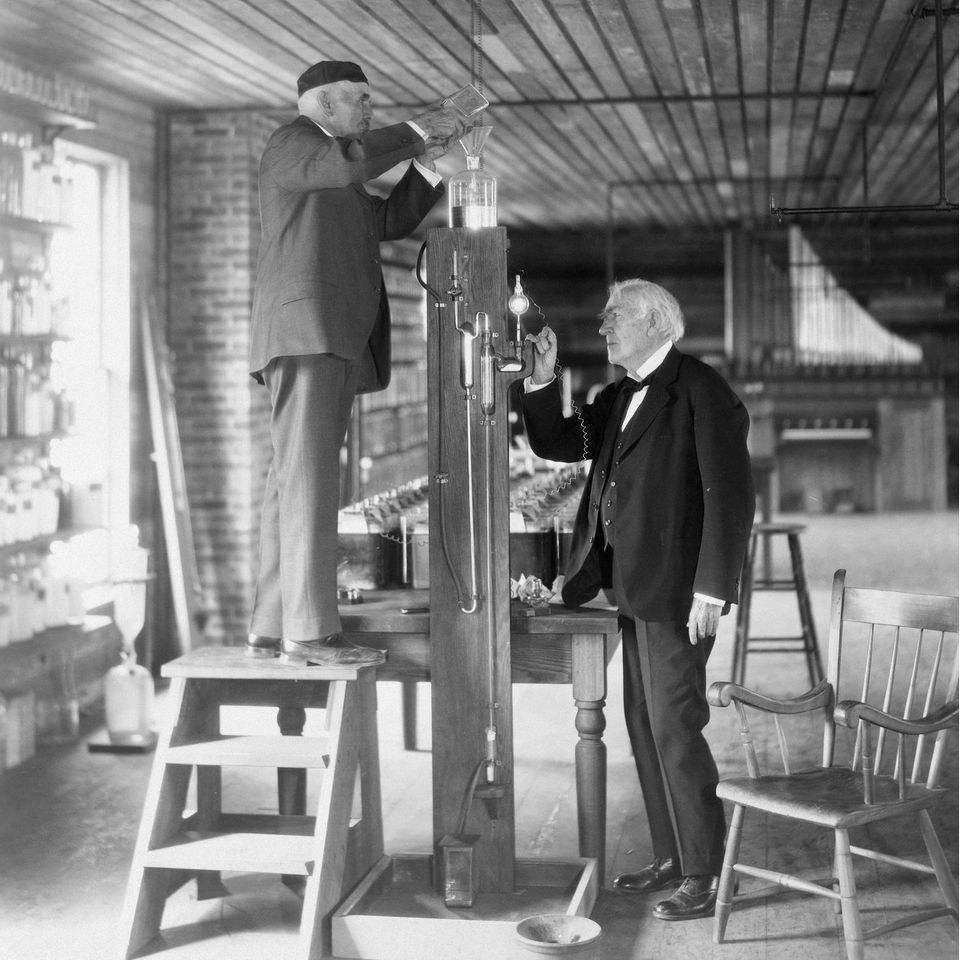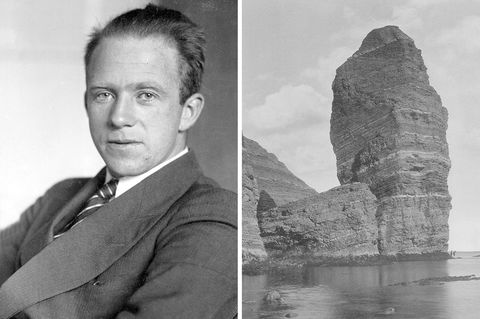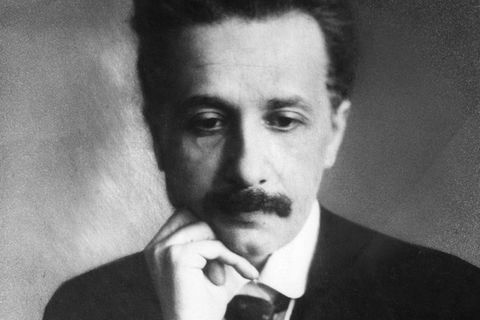Bernstein, an Katzenfell gerieben, lädt sich auf: Diese Entdeckung brachte schon die alten Griechen auf die Spur der Reibungselektrizität. Tatsächlich ist das Phänomen im Alltag überall. Es lässt unsere Haare zu Berge stehen, wenn wir mit einem Ballon darüber rubbeln. Es lässt Pollen an Hummelbeinen und Styroporkugeln an Klamotten haften. Es lädt unseren Körper elektrostatisch auf, wenn wir mit Gummisohlen über Synthetikteppich schlappen (der kleine Stromschlag, den wir danach an der Türklinke bekommen, ist die Entladung). Sogar Staubpartikel im Universum klumpen seinetwegen zu Planetenkeimen zusammen.
Um Reibungselektrizität zu erzeugen, ist interessanterweise keine Reibung nötig. Der enge Kontakt zwischen zwei Oberflächen genügt. Zwei neutrale Gegenstände berühren sich, und wenn sie sich wieder trennen, sind sie gegensätzlich geladen. Doch wie genau wechselt dabei Ladung die Seiten? Und warum?
Diese Fragen treiben die Physik schon seit Langem um. Für Metalle gibt es bereits eine Erklärung auf Ebene der Atome. Hier fließen bei Berührung negativ geladene Elektronen. Doch überraschenderweise ist der Effekt bei nicht leitenden Materialien wie Glas oder Kunststoff viel ausgeprägter. Dabei lassen sie ihre Elektronen weder leichtfertig ziehen, noch nehmen sie widerstandslos neue Ladungsträger auf. "Wir wissen bis heute nicht, ob Elektronen, Ionen (geladene Atome oder Moleküle, Anm. d. Red.) oder sogar kleine Materiebröckchen die Seiten wechseln", sagt Juan Carlos Sobarzo, Physikdoktorand am Institute of Science and Technology Austria. "Und wir wissen ebenso wenig, was die treibende Kraft hinter diesem Ladungstransfer ist."
Völlig chaotische Messergebnisse
Um Licht ins Dunkel zu bringen, versuchten Physikerinnen und Physiker seit dem 18. Jahrhundert, Ladungsreihen für verschiedene Materialien aufzustellen. 1757 schrieb der Naturforscher J. C. Wilcke erstmals, Glas lade sich bei Kontakt mit Papier positiv auf, und Papier lade sich beim Kontakt mit Schwefel positiv auf – also lade sich auch Glas beim Kontakt mit Schwefel positiv auf.
Solche Abfolgen werden als triboelektrische Ladungsreihen bezeichnet. Das Problem ist, dass sich die verschiedenen Stoffe nicht immer vorhersagbar verhalten. "Eine Myriade von Faktoren, vom Material bis zur Luftfeuchtigkeit, beeinflussen die Messungen", sagt Sobarzo. "Wie isolierende Materialien Ladungen austauschen, erschien lange Zeit völlig chaotisch", ergänzt sein Doktorvater Scott Waitukaitis. "Die Experimente sind unvorhersehbar und können manchmal völlig willkürlich erscheinen."

Als Sobarzo der Logik der Ladungsreihen auf die Schliche kommen wollte, entschied er sich deshalb, möglichst viele Einflussfaktoren zu eliminieren. All seine Proben waren kleine Würfel aus einem Kunststoff namens PDMS. Eine mechanische Vorrichtung presste je zwei Exemplare mit vorgegebener Kraft aufeinander und trennte sie danach wieder. Das Forschungsteam maß, welcher Würfel danach positiv und welcher negativ geladen war. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie nun in dem renommierten Fachjournal "Nature".
Am Anfang stand völlige Willkür. Doch nach vielen fruchtlosen Versuchen fand das Forschungsteam endlich den magischen Schlüssel: jenen entscheidenden Faktor, der Ordnung in das Chaos brachte. Es war die Zahl der Kontakte, die ein Würfel bereits erfahren hatte.
Effekt Nummer eins: Berührte ein brandneuer Würfel ein Exemplar, das bereits viele Versuche durchlaufen hatte, lud er sich positiv auf, während sich der alte Würfel negativ auflud. Effekt Nummer zwei: Pressten Sobarzo und sein Team eine feste Gruppe von Würfeln untereinander oft genug gegeneinander, verhielten sie sich zuerst unvorhersagbar, ordneten sich dann aber über viele Versuche hinweg zu einer verlässlichen Ladungsreihe. Es war, als besäßen die Kunststoffwürfel eine Erinnerung an vergangene Berührungen. Erste, unveröffentlichte Versuche, die Sobarzo mit Gummiwürfeln durchführte, zeigen einen ähnlichen Effekt.
Wie genau prägten die Kontakte die Würfel? Die Forschenden fanden nur einen einzigen Unterschied: Viele Berührungen glätteten nanometerkleine Unebenheiten auf der Oberfläche des Kunststoffs. "Der nächste Schritt wäre, nach einem Zusammenhang zwischen der Rauheit des Materials und der Ladungsübertragung zu suchen", sagt Sobarzo. "Es könnte uns helfen, das Phänomen als solches besser zu verstehen – und vielleicht sogar herauszufinden, was genau zwischen den Oberflächen übertragen wird."
Juan Carlos Sobarzo und Scott Waitukaitis fasziniert die Frage auf theoretischer Ebene. Aber sie ist auch in der Praxis relevant. Die chemische Industrie beispielsweise würde Puderpartikel zu gern daran hindern, in Produktionsanlagen zu verklumpen oder durch elektrostatische Aufladung Staubexplosionen auszulösen. Die Ingenieurswissenschaften hingegen möchten sich den Effekt der Reibungselektrizität zunutze machen, um Batterien zu laden oder Energie für kleine elektronische Bauteile zu generieren.