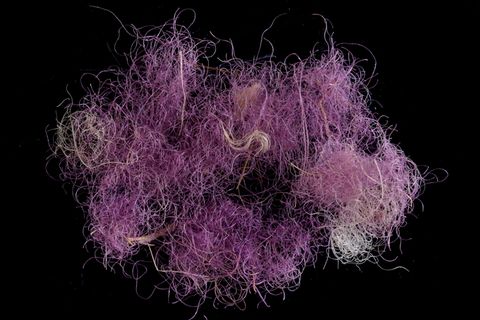Mit mehr als 2000 Substanzen sind Azofarbstoffe die größte Gruppe synthetischer Farbstoffe. Lediglich neun von ihnen sind in der EU als Zusatzstoffe für Lebensmittel zugelassen: Tartrazin (E102), Gelborange S (E110), Cochenillerot A (E124), Azorubin (E122), Amaranth (E123), Allurarot AC (E129), Brilliantschwarz BN (E151), Braun HAT (E155) und Litholrubin BK (E180). Sie lassen beispielsweise Käse appetitlich gelb erscheinen, schenken Süßigkeiten ihre Farbenpracht, Lakritz sein tiefes Schwarz und dem Likör Aperol sein leuchtendes Orangerot.

Für die Lebensmittelindustrie sind Azofarbstoffe wahre Wundermittel. Sie färben intensiv, sind günstig herzustellen, verblassen und verderben nicht, besitzen weder Eigengeschmack noch Nährwert. Doch immer wieder stehen sie wegen gesundheitlicher Bedenken in der Diskussion.
Insbesondere eine britische Studie aus dem Jahr 2007 deutete darauf hin, dass künstliche Farbstoffe in Kombination mit anderen Zusätzen die Jüngsten hibbelig und launisch machen. Auch wenn die EU an der Aussagekraft dieser Arbeit zweifelte, verfügte sie, dass sechs Azofarbstoffe auf Lebensmittelverpackungen mit der Warnung "Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen" gekennzeichnet werden müssen.
Azofarbstoffe als Auslöser von Pseudoallergien
Seither haben weitere Forschungsarbeiten einen möglichen Zusammenhang zwischen bestimmten Azofarbstoffen und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern aufgezeigt. Dabei sind nicht alle Kleinen gleich anfällig: "Bei der Empfindlichkeit gegenüber synthetischen Lebensmittelfarbstoffen scheint es erhebliche individuelle Unterschiede zu geben", schreibt ein Forschungsteam, das die verfügbaren Arbeiten 2021 im Auftrag des kalifornischen Amtes für Umwelt- und Gesundheitsgefahren auswertete.
Azofarbstoffe können auch körperliche Reaktionen, sogenannte Pseudoallergien, auslösen. Im Gegensatz zu echten Allergien bildet das Immunsystem dabei keine Antikörper gegen die Substanz. Die Symptome ähneln sich jedoch: Rötungen, Juckreiz, geschwollene Schleimhäute, eine laufende Nase, im schlimmsten Falle Kreislaufversagen. Schuld daran ist eine Entzündungsreaktion, die umso heftiger ausfällt, je größere Mengen des Auslösers verzehrt werden.
Bei Azofarbstoffen könne es außerdem zu Kreuzreaktionen kommen, "wenn bereits eine Unverträglichkeit gegen Salicylsäure und ihre Abkömmlinge oder gegen Benzoesäure (E 210) besteht", schreibt die Verbraucherzentrale Hamburg. "Für Menschen mit Erkrankungen wie Asthma oder Neurodermitis gelten sie ebenfalls als bedenklich."
Es gibt noch eine weitere Sorge. Da sich einige Azofarbstoffe im Körper zu krebserregenden Verbindungen zersetzen können, stehen auch die Lebensmittelfarben unter Verdacht. Ein eindeutiges Bild der Giftigkeit für den Menschen zeichnen die verfügbaren Studien allerdings nicht. Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit überprüfte bis 2016 alle zugelassenen Farbstoffe; niedrige Werte für die erlaubte Tagesdosis sollen Risiken ausschließen.
Warum ist die Beweislage so schwammig, trotz zahlreicher Studien? Für Azofarbstoffe gilt genau wie für zahlreiche andere Zusatz- und Inhaltsstoffe: Ihre Wirkung im Körper ist schwierig nachzuweisen. In Tierversuchen zeigen sich schädliche Effekte oft erst deutlich oberhalb der empfohlenen Tagesdosis; ohnehin sind die Ergebnisse nicht ohne Weiteres von einer Spezies auf die andere übertragbar. Bei Menschen ist die Herausforderung, aus der Vielzahl der Faktoren, die unsere Gesundheit beeinflussen, die Effekte einzelner Stoffe herauszuarbeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Substanzen nur schwer einzuschätzen sind.
Auf der sicheren Seite ist, wer sich bei industriell verarbeiteten Lebensmitteln zurückhält. Viele Produkte, die mit Azofarbstoffen leuchtend eingefärbt sind, enthalten auch andere Zutaten, die es in Maßen zu genießen gilt. Wer gern Aperol trinkt, sollte die krebserregende Wirkung des Alkohols nicht ignorieren. Und wer packungsweise quietschbunte Süßigkeiten in sich hinein schaufelt, konsumiert vermutlich mehr Zucker, als dem Körper guttut.