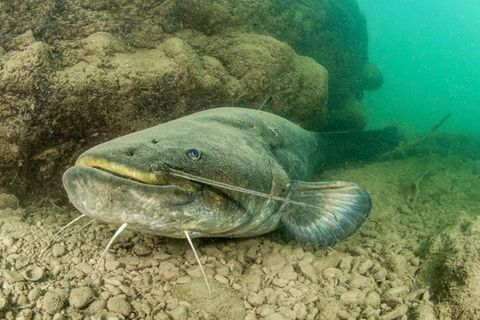Mit den ersten frostkalten Nächten wird es für die meisten Pilze ungemütlich im Wald: Pfifferlinge, Maronen, Stockschwämmchen und Co. haben zu dieser Zeit ihre Fruchtphase meist hinter sich, Temperaturen unter null behagen ihnen nicht. Denn sobald das Wasser in ihren Zellen gefriert, entstehen voluminöse, scharfkantige Eiskristalle, die das filigrane Pilzgewebe zerstören. Pech, wer eine Herbstnacht erwischt, in der das Thermometer früh im Jahr in die Zitterzone weist.
Der nicht zufällig Winterpilz genannte Samtfußrübling lässt sich von tiefen Temperaturen dagegen wenig beeindrucken. Im Gegenteil: Um seinen Fruchtkörper auszubilden, benötigt er als Starthilfe sogar null Grad Celsius. Und selbst minus 25 Grad, so wollen Pilz- freunde schon beobachtet haben, können ihm nichts anhaben. Zwar stellt er bei derart polaren Bedingungen sein Wachstum ein, bleibt aber unbeschadet.
Wie schafft er das? Das Frostgenie macht sich einen Trick zunutze, den auch manch anderes Lebe- wesen gegen drohenden Kältetod hervorgebracht hat: Der Pilz bildet gewissermaßen sein eigenes Frostschutzmittel — ein besonderes Protein, das sich an kleinste Eiskristalle bindet und so deren weiteres Wachstum hemmt. Dadurch können sich die winzigen Kristalle nicht zu größeren vereinigen, der Zellsaft bleibt flüssig. Anders ausgedrückt: Der Gefrierpunkt ist durch diesen biologischen Kniff deutlich herabgesetzt.
Zur Freude von Sammlern: Der Samtfußrübling, der in kleinen Büscheln oft reichlich auf Stämmen, Stümpfen und herabgefallenen Ästen wächst, macht sich wunderbar in Suppen — und spendet gerade in der kalten Jahreszeit viel Vitamin C. In Japan kommt er als „Enoki“ auf den Tisch und ist dort derart beliebt, dass er massenhaft kultiviert wird: 100000 Tonnen beträgt die stattliche Jahresproduktion!