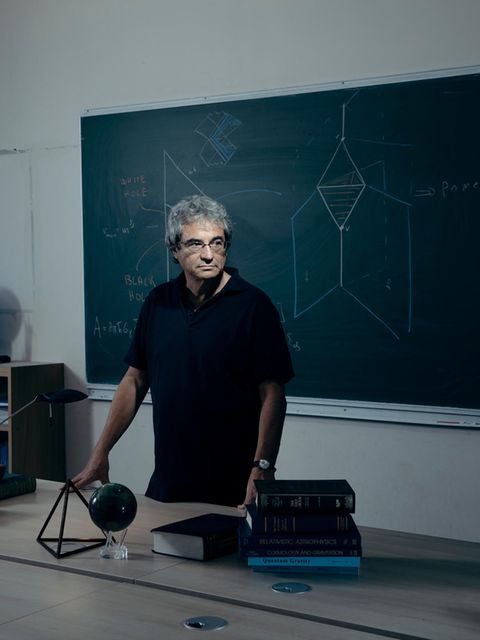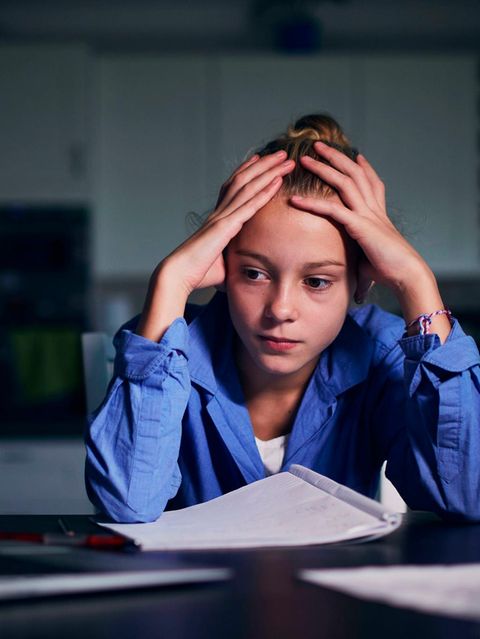Eltern von Kleinkindern fragen sich nicht selten, ob der Nachwuchs einen heimlichen Todeswunsch hegt. Wenn man nicht aufpasst, hechten die Kleinen mit einem Kopfsprung vom Sofa, brettern mit dem Laufrad auf die Straße, stopfen sich giftige Beeren in den Mund und Erbsen in die Nase. Sie sind wieselflink, aber besitzen nicht einen Hauch von Risikobewusstsein. Abends ist man froh, sein Kind halbwegs heil durch den Tag gebracht zu haben.
Da wundert es fast, dass statistisch gesehen das Jugendalter die risikoreichste Entwicklungsphase ist. Statistiken aus den USA zeigen: Im Alter von zehn bis 19 Jahren sind Verletzungen die häufigste Todesursache, unter anderem durch Unfälle im Straßenverkehr und beim Sport, durch Schusswaffen- oder Drogenmissbrauch, aber auch durch selbstverletzendes Verhalten. Studien aus Unfallkrankenhäusern belegen, dass Jugendliche sich besonders oft die Knochen brechen, meist bei sportlichen Aktivitäten. Mit zunehmendem Alter tut sich auch ein Geschlechterunterschied auf. Während deutsche Jungen und Mädchen als Kleinkinder nahezu gleich häufig wegen Unfallverletzungen in ärztlicher Behandlung sind, haben männliche Teenager einen klaren Vorsprung.
Selbstgefährdung für die Selbstfindung
Es gibt vielerlei Gründe dafür, dass Heranwachsende über die Stränge schlagen. Sie suchen ihre Identität, ringen um Selbstwert, grenzen sich von den Eltern ab, wollen vor ihrem Freundeskreis bestehen. Gleichzeitig lernen sie gerade erst, langfristig zu denken, Risiken realistisch einzuschätzen und ihre Impulse zu kontrollieren. Die Kinderpsychiater Franz Resch und Peter Parzer schreiben: "Risikoverhalten ist durch mangelnde Selbstfürsorge, mangelndes Gesundheitsbewusstsein und mangelnde soziale Umsicht gekennzeichnet, steht aber grundsätzlich im Dienste des Selbst." Zu einem gewissen Grad gehören Leichtsinn und Grenzüberschreitungen zum Erwachsenwerden. Zeit für Vernunft ist später noch.
Doch ist die Jugend von Natur aus die Zeit maximaler Risikobereitschaft, oder ist das Phänomen eine Folge menschlicher Kultur und Erziehung? Diese Frage ist empirisch nicht leicht zu beantworten, weil sich Feldversuche mit unbeaufsichtigten Kleinkindern verbieten. Forschende der University of Michigan und der James Madison University in den USA umgingen das Problem nun auf geschickte Weise: Sie beobachteten stattdessen 119 Schimpansen aller Altersgruppen im Kibale-Nationalpark in Uganda. Die körperlichen und geistigen Entwicklungsphasen unserer nächsten Verwandten sind den unseren sehr ähnlich. Außerdem haben Schimpansenjunge aufmerksame Mütter: In den ersten zwei Lebensjahren tragen die Weibchen sie in der Regel am Körper oder lassen sie in Reichweite herumturnen.
Nun bewegen sich die Primaten nicht im Straßenverkehr, fahren Skateboard oder verschlucken Knopfbatterien. Aber sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit in Bäumen. Stürze aus mehreren Metern Höhe bergen für sie eine gravierende Verletzungsgefahr. Um das Risikoverhalten aller Altersgruppen einzuschätzen, werteten die Forschenden deshalb aus, wie viel Zeit die Schimpansen im "freien Flug" verbrachten, wenn sie von Ast zu Ast sprangen oder sich auf einen tiefergelegenen Zweig fallen ließen, ohne sich festzuhalten. Außerdem schätzten sie ab, in welcher Höhe diese Manöver stattfanden.
Je jünger, desto wilder
Die Ergebnisse zeigen: Schimpansen sind nicht in ihrer Jugend, sondern in ihrer frühesten Kindheit besonders waghalsig. Vom dritten bis zum fünfzehnten Lebensjahr nimmt ihr physisch riskantes Verhalten durchgehend ab, bevor sie schließlich zu umsichtigen Erwachsenen reifen.
In den ersten zwei Lebensjahren hielten sich die Babys meist an der Mutter fest, weshalb das Forschungsteam die Allerkleinsten aus der Datenanalyse ausschloss. Vom dritten bis fünften Lebensjahr nahm der Bewegungsradius der Kleinen zu. In dieser Zeit legten sie dreimal so oft riskantes Verhalten an den Tag wie die Großen. Vom sechsten bis zehnten Lebensjahr sank dieser Faktor auf 2,5 und im Alter von elf bis 15 Jahren auf 2,1. "Mit jedem zusätzlichen Lebensjahr verringerte sich die Wahrscheinlichkeit, sich risikoreich zu verhalten, um 2,8 Prozent", schreibt das Autorenteam um Neurowissenschaftler Bryce Murray in der Fachzeitschrift "iScience". Weder das Geschlecht noch die Höhe über dem Boden spielten dabei eine nennenswerte Rolle.
Warum sind ausgerechnet die Kleinsten so risikofreudig? Bryce und seine Kolleginnen liefern zwei Erklärungsansätze. Der erste lautet, dass sie es sich leisten können. Sie sind kleiner, leichter, und ihre Knochen federn Stürze besser ab. Wenn sie fallen, riskieren sie vermutlich weniger gravierende Verletzungen. Der zweite Ansatz besagt, dass sie niemand davon abhält. Bei Schimpansen sind nahezu ausschließlich die Mütter für das Wohl ihrer Jungen zuständig. Sobald die Kleinen alt genug sind, um allein im Blätterdach herumzuklettern (und die Mutter womöglich mit einem jüngeren Geschwisterchen beschäftigt ist), können sie weitgehend treiben, was sie wollen.
Die Forschungsergebnisse legen nahe: Auch Menschenkinder würden in jungem Alter womöglich die größten Risiken eingehen – wenn man sie denn ließe. Die Forschenden schreiben: "Es gibt zwar eindeutige Belege dafür, dass die Jugend die risikoreichste Phase in der menschlichen Entwicklung ist, doch eine wachsende Zahl von Veröffentlichungen deutet darauf hin, dass dieses Phänomen eher eine Folge gelockerter Beschränkungen als einer erhöhten Neigung dieser Altersgruppe ist." Kaum lockert sich der elterliche Klammergriff, ist endlich Raum für wilde Experimente.
Dass die Jüngsten gut behütet sind, ist dabei kein Phänomen des Globalen Nordens und seiner berüchtigten Helikoptereltern. In Gesellschaften, in denen Eltern und Erzieher nicht allzeit zur Stelle sind, übernehmen oft ältere Geschwister, Spielkameraden oder Großeltern die Aufsicht – und retten die Kleinen vor den Folgen ihrer ungezügelten Neugier. Doch ein bisschen Wagemut ist durchaus wünschenswert. Im wilden Spiel könnten Kinder "riskante Verhaltensweisen sicherer ausprobieren", schreiben Anthropologin Laura MacLatchy und Biologin Lauren Sarringhaus, Mitautorinnen der aktuellen Veröffentlichung. Spielgeräte wie Klettergerüste bieten nicht nur Nervenkitzel, sondern fördern auch die motorischen Fähigkeiten. So gehen gelegentliche Unfälle im besten Fall glimpflicher aus.