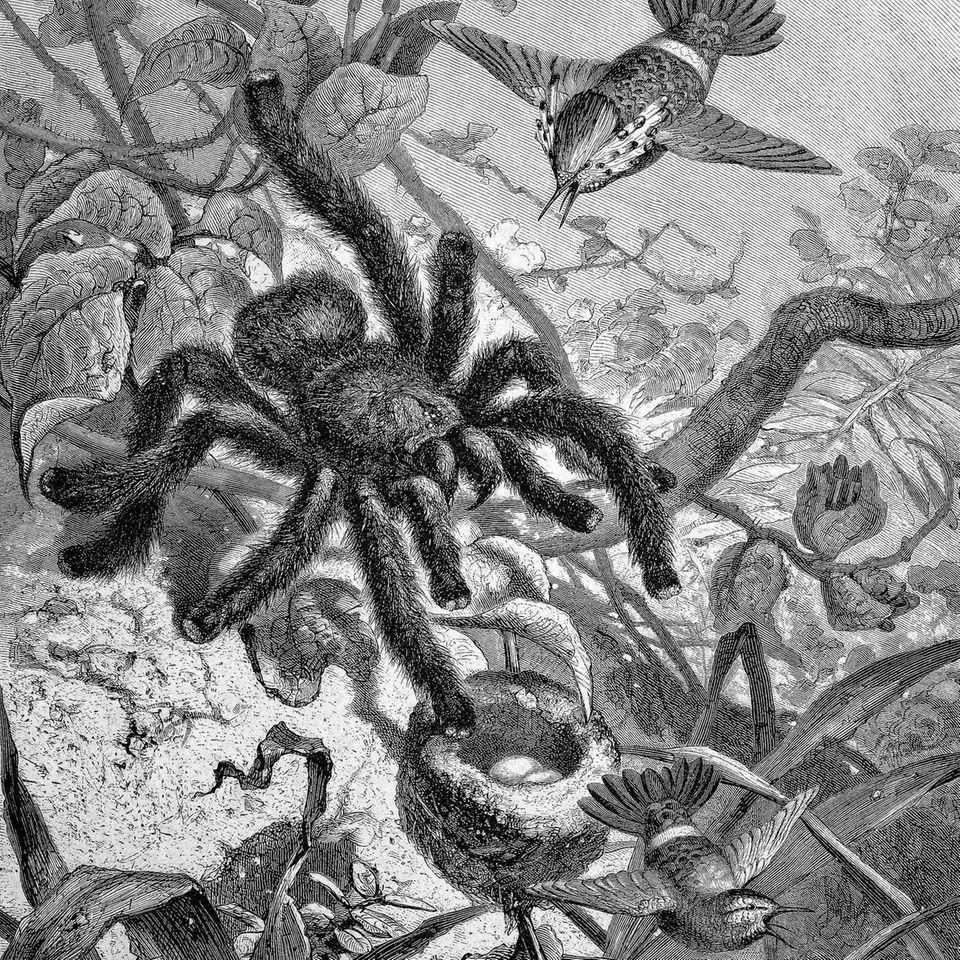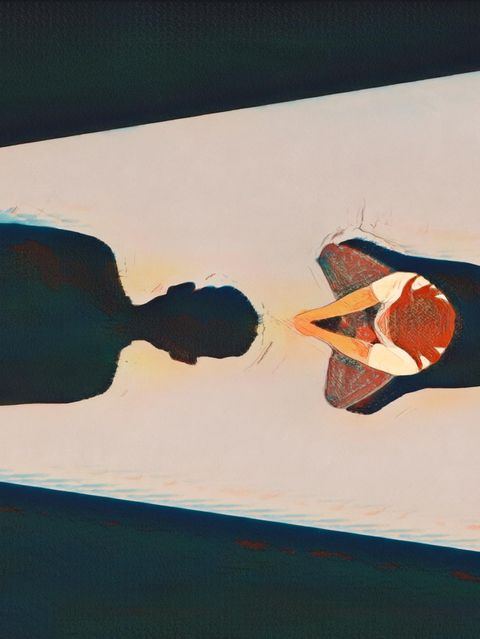Eine stockdunkle Höhle. Eine enge Passage. In der Luft: der faulige Geruch von Schwefelwasserstoff und das Summen unzähliger Mücken. An der Felswand: ein gigantisches Spinnennetz, in dem sich mehr als 100.000 Achtbeiner tummeln. Der Stoff, aus dem Albträume sind?
István Urák, Biologieprofessor an der Universität Sapientia im rumänischen Transsilvanien, empfindet anders. Er leitete ein Forschungsteam, das die 2021 entdeckte Spinnengemeinschaft über drei Jahre hinweg im Detail erforschte. "Würde ich versuchen, all die Emotionen in Worte zu fassen, die mich überwältigten, würde ich vor allem Bewunderung, Respekt und Dankbarkeit hervorheben", sagte er dem Portal "Livescience.com". "Man muss es selbst erleben, um wirklich zu verstehen, wie es sich anfühlt."
Ein Ökosystem, gespeist von chemischer Energie
Die ungewöhnliche Kommune aus Achtbeinern lebt nahe dem Eingang einer Kalksteinhöhle auf der Grenze von Albanien und Griechenland. Im Innersten der gut 500 Meter langen Höhle entspringt warmes, schwefelhaltiges Wasser, das als Bach zum Eingang strömt und ihr den Namen "Sulfur Cave", Schwefelhöhle, bescherte. Sie liegt ganz in der Nähe der Atmos-Höhle, in der kürzlich der wohl größte unterirdische Thermalsee der Welt entdeckt wurde.
Die unterirdischen Quellen speisen ein florierendes Ökosystem in völliger Dunkelheit. Seine Grundlage bilden Mikroben, die ihre Energie nicht aus Sonnenlicht, sondern aus Schwefelverbindungen gewinnen. Sie wuchern über und unter Wasser in dichten Biofilmen, die wiederum Asseln, Springschwänzen und weiteren Winzlingen als Nahrungsgrundlage dienen. Begehungen der Höhle in den vergangenen zwei Jahren förderten mehr als 40 Tierarten zutage, darunter Fische, Skorpione, Hundertfüßer und Fledermäuse.

© Urak et al. 2025, Subterranean Biology, CC BY 4.0
Die Spinnen bilden einen ganz besonderen Teil dieser Gemeinschaft. Ihr gigantisches Netz am Eingang der Höhle besteht aus vielen einzeln gewobenen Trichtern, die sich zu einem 106 Quadratmeter großen, klebrigen Flickwerk vereint haben. Individuen zweier Arten tummeln sich darin. Urheberinnen der Netze sind Hauswinkelspinnen (Tegenaria domestica), deren Zahl die Forschenden auf 69.000 Exemplare schätzen. Als Mitbewohnerinnen haben sich mehr als 42.000 Baldachinspinnen der deutlich kleineren Spezies Prinerigone vagans einquartiert.
Beide Arten sind weit verbreitet, auch in Deutschland. Über Tage führen sie jedoch ein einzelgängerisches Leben. Dass sie in der Höhle Kolonien bilden – noch dazu gemeinsam mit einer anderen Art –, ist für die Arachnologie eine kleine Sensation. Derart große Lebensgemeinschaften sind von Spinnen bisher vor allem aus warmen Gefilden bekannt. In einer Höhle wurden sie bislang noch nie beschrieben.
Die Forschenden vermuten, dass der enorme Ressourcenreichtum der Sulfur Cave, der sich aus den Schwefelquellen speist, das Zusammenleben begünstigt. Die Spinnen füllen ihre Netze und Mägen mit Zuckmücken, deren Larven sich von den Biofilmen der Schwefelwasserstoff fressenden Mikroben ernähren. Die ausgewachsenen Insekten bilden in der Nähe des Höhleneingangs dichte Schwärme aus Millionen von Tieren. Den Hauswinkelspinnen könnten theoretisch auch die Baldachinspinnen als Beute dienen. Doch entweder ist eine solche Störung des WG-Friedens aufgrund der Mückenfülle nicht nötig – oder die Größeren erkennen die Kleineren in der Finsternis einfach nicht. Jedenfalls blieb der Anteil der Arten in der Kolonie über Monate und Jahre hinweg stabil.
Die isolierten Höhlenspinnen haben sich auch genetisch von ihrer Verwandtschaft entfernt. "Molekulare Belege deuten darauf hin, dass die Population der Schwefelhöhle keine Individuen mit [Populationen an] der Oberfläche austauscht", schreibt das Forschungsteam in der Fachzeitschrift "Subterranean Biology". Sogar ihr Mikrobiom hat sich offenbar der neuen, schwefelreichen Ernährung angepasst. Vorläufige Untersuchungen legen nahe, dass die Bakteriengemeinschaft im Körper der Spinnen an Vielfalt verloren hat. Aktuell nehmen die Forschenden um István Urák das einzigartige Ökosystem in der Höhle noch umfassender unter die Lupe.
Die Rekordhalterin unter den Webspinnen
Wer über die weltgrößten Spinnennetze schreibt, muss der Vollständigkeit halber auch der Darwin-Rindenspinne Caerostris darwini Tribut zollen. Die madagassische Spinne wurde 2011 erstmals beschrieben. Sie ist kaum zwei Zentimeter lang, webt aber – ganz allein – beeindruckende Netze mit einer Fläche von nahezu drei Quadratmetern. Die Ankerfäden können bis zu 25 Meter messen und Flüsse überspannen. Mit dieser Leistung brachte es die kleine Achtbeinerin ins Guiness-Buch der Rekorde.