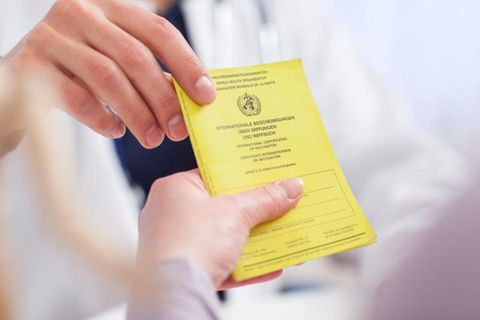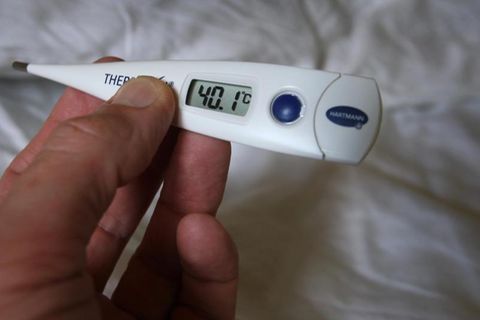Bei Halskratzen oder Bauchgrummeln greifen wir schnell zu Medikamenten. Gerade der Griff zu natürlichen Heilmitteln ist beliebt. Denn pflanzliche Arzneien gelten als milder und verträglicher für unseren Körper. Schon unsere Vorväter wussten ihre Beschwerden durch Naturmittel zu kurieren. Die "sanfte Medizin" verschafft uns das Gefühl, bewusster mit uns und unserer Umwelt umzugehen.
Die Wirkung einiger Naturheilmittel ist bisweilen umstritten. Doch unstrittig ist, dass der hohe Bedarf der Konsumenten die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren bedroht.
Allein über 400.000 Tonnen Heilpflanzen-Rohware gelangen nach Angaben des WWF jährlich in den internationalen Handel - und der Bedarf steigt. Davon stammen etwa 80 Prozent dieser weltweit genutzten Arten aus sogenannten Wildsammlungen. Nicht nachhaltige Sammelmethoden oder -mengen stellen ein großes Problem dar. So werden teilweise Pflanzen von Sammlern aus dem Boden gerissen oder gegraben - ohne Rücksicht darauf, dass sie nicht wieder nachwachsen können. Häufig werden lediglich Pflanzenteile wie die Blätter für die Produktion der Medikamente verwendet, sodass ein Ausreißen des ganzen Gewächses nicht notwendig wäre.
Nachhaltige Ernte und auch der Anbau wären bei vielen Pflanzen durchaus möglich, sind für Händler aber teurer. Schließlich geht es darum, so günstig wie möglich zu produzieren - bis die Ressourcen ausgehen: Die Weltnaturschutzunion (IUCN) vermutet, dass bis zu 15.000 Heilpflanzenarten in ihrem Bestand gefährdet sind.
Auch Deutschland trägt einiges zum Raubbau an der Natur bei. Nach Angaben des WWF ist Deutschland in Europa die Nummer eins unter den Nutzern und Händlern von Heilpflanzen. Weltweit ist das Land sowohl beim Import als auch beim Export unter den Top 5. Die importierte Pflanzenware, vor allem aus Ost- und Südosteuropa, wird größtenteils hierzulande weiterverarbeitet und dann wieder vertrieben. Die fertigen Produkte werden legal in Apotheken und Drogerien verkauft.
Nicht nur Wildpflanzen sind gefragt
Während sich die westliche Schulmedizin insgesamt verstärkt auf pflanzliche Heilmittel zurückbesinnt, stützt sich die traditionelle Medizin außerhalb Europas seit jeher auf die Naturheilmittel. In diesen werden neben pflanzlichen auch tierische Wirkstoffe genutzt.
So verwendet die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), vor allem in Asien, auch heute noch in ihren Mitteln Substanzen von 1500 Tierarten. Viele Präparate enthalten Organe von Wildtieren. Denn deren Wirkung sei, so glaubt die TCM, stärker als die von Zuchttieren. In China gibt es zudem einen großen Schwarzmarkt für TCM. Laut WWF werden hier tierische Organe nachgefragt, deren Handel heute offiziell verboten ist.
Die Folgen des Schwarzmarkthandels sind für den Bestand von Tierarten verheerend. Tiere von ohnehin schon dezimierten Arten werden für medizinische Zwecke weiterhin gewildert und getötet. Trotz des weltweiten Verbots der Jagd und Nutzung sind einzelne Unterarten von Tigern und Nashörnern durch Überjagung bereits ausgerottet oder extrem bedroht. Die Nachfrage nach dem Sekret des Moschustieres hat die Arten teilweise an den Rand des Aussterbens gebracht.
Artenschutz versus Schwarzmarkt
Mittlerweile sind Moschustiere, wie viele andere vom Aussterben bedrohte Pflanzen- und Tierarten, durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) geschützt. CITES regelt oder verbietet den Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Einen Schutzstatus bekommen die Arten aber oft erst, wenn sich ihr Bestand soweit dezimiert hat, dass sie vom Aussterben bedroht sind.
Doch Handelsauflagen allein reichen nicht aus. Nationale Gesetze laufen den internationalen Verordnungen teilweise zuwider. In Russland etwa ist nach wie vor die Jagd auf Moschustiere erlaubt. Ferner "gibt es für die medizinische Nutzung von Tieren keinen gemeinsamen internationalen Standard", moniert die WWF-Artenschutzexpertin Susanne Honnef. Die Schutzmaßnahmen von Tierart zu Tierart sähen grundsätzlich unterschiedlich aus.
CITES reguliert zwar den Handel mit gefährdeten, aber begehrten Tier- und Pflanzenarten, doch der illegale Verkauf blüht. Hinter dem Tierhandel stecken häufig Netzwerke, wie Patrick Brown in seiner Webreportage "Black Market" dokumentiert. Die Anreize zum Wildern sind vor allem in den Entwicklungsländern hoch: 36.000 Euro lassen sich etwa auf dem Schwarzmarkt für ein Kilo Moschus vom Moschustier erzielen. Dagegen sind die Strafen bei Missachtung nationaler Naturschutzgesetze, etwa in Vietnam und Indonesien, sehr gering.
Um illegale Jagd und den artenbedrohenden Raubbau einzudämmen, entwickeln WWF und TRAFFIC (das gemeinsame Programm von WWF und der Weltnaturschutzunion IUCN) seit Jahren Strategien für eine nachhaltige Wildartennutzung - mit Rücksicht auf die Sammler und Jäger, die auf den Handel angewiesen sind. So gibt es seit 2010 den weltweit ersten Nachhaltigkeitsstandard für Wildpflanzen - den FairWild Standard. Er regelt die "umweltverträgliche, sozial gerechte und ökonomisch tragfähige Wildsammlung von Pflanzen, Pilzen und Flechten", berichtet WWF-Artenschutzexpertin Susanne Honnef. Der Standard umfasst Richtlinien für das Sammeln und Handeln von Wildpflanzen. Es darf nur so viel gesammelt werden wie nachwachsen kann. Zudem sollen Arbeiter faire Löhne erhalten. Da dieser Standard die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze und Richtlinien fordert, kann er in Zukunft zur Eindämmung des illegalen Handels beitragen - zumindest mit geschützten Wildpflanzen.

















![Hirnforschung: "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert](https://image.geo.de/37054408/t/nc/v16/w480/r0.75/-/migraene-cover.jpg)